Drug-Checking -
|
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
5. Drug-Checking -
Zukünftiges Präventionsinstrument der Drogenhilfe?
Von der Drogenprävention zur Drogenmündigkeit Angesichts der nicht zu verheimlichenden (general-)präventiven Ineffektivität von reiner Strafbedrohung und Bestrafung des illegalisierten Drogenkonsums, haben Bundesregierung und Länderregierungen in ihren drogenpolitischen Programmen der Vergangenheit zunehmend die Bedeutung drogenpräventiver Bemühungen als Ergänzung repressiver Maßnahmen zur Reduzierung der Nachfrage nach den verbotenen Drogen herausgestellt. Heute wird die Drogenprävention bzw. die Suchtprävention - wie man sie inzwischen eher bezeichnet - von vielen Institutionen und Menschen in der Bundesrepublik als wichtige gesellschaftliche Aufgabe angesehen und eingeklagt. Der Prävention wird eine zentrale Bedeutung bei der »Lösung des Suchtproblems« zugewiesen. Inwieweit Drogen- bzw. Suchtprävention im Rahmen der Konsumgesellschaft - deren höchstes Ziel ja gerade die Abhängigkeit möglichst vieler Menschen von möglichst vielen Produkten ist - überhaupt als sinnvoll erscheint und Aussicht auf Erfolg hat, kann hier leider nicht näher erörtert werden, sollte hier aber wenigstens als kleiner Denkanstoß erwähnt werden.
Verschiedene sich gegenseitig ablösende, teilweise aber auch aufeinander aufbauende Leitkonzepte haben die drogen- bzw. suchtpräventive Arbeit der Drogenhilfe innerhalb der letzten 30 Jahre bestimmt. Dem Dipl.-Psychologen und Professor für Sozialmedizin und Gesundheitswissenschaft Peter Franzkowiak folgend, lassen sich zahlenmäßig vier Phasen der Drogen- bzw. Suchtprävention mit jeweils neuen konzeptionellen Positionen und Praxisansätzen unterscheiden, wobei der Schritt in die neueste, vierte Phase noch nicht eindeutig vollzogen ist:
- Drogenprävention
- Suchtprävention/Suchtprophylaxe
- Entwicklungs- und Gesundheitsförderung
- Risikobegleitung und Risikomanagement (?).
5. 1 Drogenprävention Noch in den 70er Jahren konzentrierte sich die Arbeit auf die sogenannte »Drogenprävention«, d.h. die Droge selber wurde etwas kurzsichtig als die Ursache allen Übels angesehen. Zu dieser Zeit war die Prävention geprägt vom sogenannten »humanbiologischen Modell«, in dem die Darstellung biologischer Abläufe im Körper und die Beschreibung der Körperfunktionen als Grundlage der Aufklärung eine entscheidende Rolle spielte. Um dieses Modell noch effektiver zu gestalten, versuchte man der »Aufklärungsarbeit« einen möglichst abschreckenden Charakter zu verleihen, wie auch insgesamt der Schwerpunkt der präventiven Arbeit in dieser Zeit hauptsächlich auf Maßnahmen der Abschrekkung potentieller Konsumenten gelegt wurde (»Abschreckungspädagogik«). Beliebt war (und ist im kommerziellen Medienbereich noch heute) in diesem Zusammenhang die Gleichsetzung von (illegalisierten) Drogenkonsum mit dem Tod, wobei man bevorzugt auf die suggestive Wirkung einer breiten Darstellung entsprechender Szenarien baute, wie z.B. auch auf jenes klassische Szenario der auf Bahnhofs- oder auch anderen Toiletten verstorbenen Fixer. Auf diese Weise sollte nun also der »Kampf gegen die Drogen« gewonnen werden. Im Zentrum der auf pauschale Abschreckung setzenden »Aufklärungsarbeit« standen gefahrenbetonende Botschaften, informationslastige Angstmacherstrategien, breite Darstellung von Verelendungs- und Krankheitskonsequenzen und scheinobjektive, negativ überzeichnete Stoffkunde. Man nahm an, Strafandrohung, Dramatisierung und Übertreibung würden abschreckend wirken. Angesichts einer konsequenten jährlichen Steigerung der erstauffälligen Konsumenten, sah man dieses Konzept allerdings bald als gescheitert an, ja sogar von einem kontraproduktiven Effekt der abstinenzorientierten, auf Abschreckung setzenden »Drogenprävention« war die Rede. Fünf Gründe wurden wesentlich für das Scheitern des Konzepts verantwortlich gemacht:

Das Konzept der abstinenzorientierten »Drogenprävention« hatte unübersehbar doppelmoralischen Charakter. Diese Doppelmoral der Drogenprävention kam vor allem angesichts einer dem exzessiven Verbrauch der legalen Drogen (Alkohol, Nikotin, Psychopharmaka) zugewandten Gesellschaft zum Ausdruck. Außerdem blieb es (und bleibt noch heute) unverständlich, warum die ansonsten hochgeschätzte Konsumfreiheit sowie der ansonsten respektierte Rechtsgrundsatz der Straffreiheit für Selbstschädigung, im Zusammenhang mit dem Gebrauch bestimmter psychoaktiver Substanzen keine Berechtigung haben sollten.
Der Reiz des Verbotenen machte viele Heranwachsende erst richtig neugierig. Das Drogenverbot stellte so für viele Jugendliche eine verführerische Aufforderung dar, die sie erst richtig scharf auf die illegalisierten Substanzen werden ließ. Wie Schlömer berichtet, bestätigen die Erfahrungen aus den Niederlanden diese These:
»Die für die 80er Jahre festgestellte Rückläufigkeit des Cannabiskonsums in den Niederlanden führen niederländische Experten [...] u.a. auf einen Attraktivitätsverlust des Konsums der illegalen Drogen zurück. Diese Attraktivitätseinbuße wird nachvollziehbar auf die de facto praktizierte Entkriminalisierung des Gebrauchs der illegalisierten Drogen zurückgeführt
 .«
.«
Unglaubwürdigkeit, infolge der einseitig und überzogen negativen Darstellung illegalisierter Drogen, unter Ausblendung ihrer positiven Aspekte wie z.B. Heil- bzw. Problemlinderungs- und Genußpotentiale. Zudem mußten abschreckende Botschaften in bezug auf die illegalisierten Drogen aus dem Munde derjenigen, die mit den legalen Drogen offensichtlich ihre massiven Probleme haben, unglaubwürdig wirken. Aus der Kommunikationsforschung ist außerdem bekannt, »... daß rein negative Botschaften, wenn sie dazu noch von amtlicher Seite propagandamäßig verbreitet werden, bei den Adressaten Manipulationsverdacht aufkommen lassen und unterschwellige Widerstände erzeugen können
 .« Zusätzlich provozierte die auf diese Weise selbstverschuldete Unglaubwürdigkeit bei den Grenzüberschreitern eine
gefährliche Bagatellisierung tatsächlich zu berücksichtigender Konsumrisiken. Nach dem Motto »Das ist ja eh alles nicht so schlimm wie gesagt wird !« wurde dann äußerst unreflektiert alles »eingefahren« was
da war.
.« Zusätzlich provozierte die auf diese Weise selbstverschuldete Unglaubwürdigkeit bei den Grenzüberschreitern eine
gefährliche Bagatellisierung tatsächlich zu berücksichtigender Konsumrisiken. Nach dem Motto »Das ist ja eh alles nicht so schlimm wie gesagt wird !« wurde dann äußerst unreflektiert alles »eingefahren« was
da war.Die Bedeutung des aus entwicklungspsychologischer Sicht normalen »Risikoverhaltens« von Heranwachsenden wurde unterschätzt. Schlömer macht dazu folgende Bemerkungen:
»Für die Lebensphase Jugend ist Experimentier- und auch Risikoverhalten normal, ja unentbehrlich für die persönliche Entwicklung. Im Umgang mit Risiken testen Jugendliche ihre Fähigkeiten und Grenzen. Wie Peter Franzkowiak im Rahmen seiner [...] Studie über den »Stellenwert von Rauchen und Alkoholkonsum im Alltag von 15- bis 20jährigen« nachweisen konnte, »ist das Aufsspielsetzen ihrer körperlichen Unversehrtheit und Leistungsfähigkeit für Jugendliche eher eine Option der Selbstverwirklichung und Erkundung als ein Einstieg in evtl. drohende [...] Gesundheitsschäden« [...]. Überdramatisierungen solcher Verhaltensweisen sind bei der Selbstfindung hinderlich
 .«
.«
Die Effektivität kognitiver Wissensvermittlung wurde überschätzt. Die Rolle irrationaler, emotionaler Faktoren bei der Entstehung problematischer Konsummuster wurde dagegen unterbewertet oder nicht erkannt.
Auch aus der Sicht von Elisabeth Pott wurde bis heute hinreichend belegt, daß mit angstauslösenden oder abschreckenden Strategien keine nachhaltigen Präventionserfolge erzielt werden können. Wissenschaftliche Untersuchungen über die Wirksamkeit von Aufklärung und Prävention belegten außerdem, so Pott, daß Informationen über biologische Abläufe im Körper allein keine positiven Verhaltensänderung im Sinne der Suchtprävention bewirken können. Schließlich sei auch die Strategie der »Drogenkunde«, die über den abhängig machenden Stoff, seine Wirkungen und von ihm ausgehende Gefahren informieren bzw. warnen, ebensowenig erfolgreich. Was die Annahme des Scheiterns der Abschreckungsstrategie betrifft, möchte ich uneingeschränkt zustimmen. Ich möchte an dieser Stelle bereits jedoch einschränkend anmerken, daß die Strategie der Drogenkunde bzw. der Aufklärung der Konsumenten über pharmakologische Aspekte des Drogenkonsums allenfalls in bezug auf das präventive Ziel der totalen Abstinenz als wenig erfolgreich zu betrachten ist. Geht es jedoch um präventive Ziele wie Gefahrenminimierung bzw. Schadensbegrenzung im Umgang mit illegalisierten Drogen, oder um Drogenmündigkeit bzw. den Erwerb von Risikokompetenz
 , so stellen nach meiner Ansicht Drogenkunde bzw. Aufklärung über
pharmakologische Aspekte des Drogenkonsums unverzichtbare Bestandteile einer erfolgreichen präventiven Arbeit dar. Ich stimme hier mit Monika Püschel überein, die, sich kritisch
mit der gegenwärtigen Praxis der Suchtprävention im Zusammenhang mit Ecstasy auseinandersetzend, zu folgendem Ergebnis kommt:
, so stellen nach meiner Ansicht Drogenkunde bzw. Aufklärung über
pharmakologische Aspekte des Drogenkonsums unverzichtbare Bestandteile einer erfolgreichen präventiven Arbeit dar. Ich stimme hier mit Monika Püschel überein, die, sich kritisch
mit der gegenwärtigen Praxis der Suchtprävention im Zusammenhang mit Ecstasy auseinandersetzend, zu folgendem Ergebnis kommt:»Es ist aber auch deutlich geworden, daß nicht ausreicht , was getan wurde. Was wir zusätzlich benötigen, ist etwas sehr Pragmatisches, nämlich Aufklärung und Konsumberatung. [...] Niemand konnte so tun, als gäbe es keine Information über diese Substanz [gemeint ist Ecstasy, d. Verf.]. Die gab es von Anfang an zuhauf. Aber leider waren diese Informationen wenig sachlich. Wenn sich die Fachleute für Suchtprävention da heraushalten, bedeutet das, daß sie einer Mythenbildung Vorschub leisten. Auch das kann die Motivation zum Drogenkonsum erhöhen. Für die Konsumenten bedeutet unsere Zurückhaltung darüber hinaus noch eine zusätzliche Gefährdung. Nämlich dann, wenn sie bei der Einschätzung des Risikos ihres Konsums auf das Hörensagen und die Einschätzung anderer Konsumenten oder der Dealer angewiesen sind. Natürlich wird keiner den Konsum einstellen, weil eine Substanz gefährlich werden könnte, wenn die Wirkung so überzeugend ist, wie sie vielfach für Ecstasy dargestellt wird. Aber vielleicht wird er oder sie die Häufigkeit des Konsums reduzieren oder sicherer konsumieren. Damit wäre schon etwas gewonnen. [...] Was wir können, sind Verhaltensregeln aufstellen und Orientierung geben. Für Ecstasy hieße das z.B., darauf hinzuweisen, daß der Konsum von zusätzlichen anderen Substanzen inklusive Alkohol wirklich gefährlich werden kann, daß Wasser oder Softdrinks in adäquater Menge getrunken werden sollten und vor allem, daß höchstens einmal im Monat eine Ecstasy genommen werden sollte. [...] Wir können in der Suchtprävention nicht so tun, als ob Suchtmittel nicht auch Genußmittel wären, die deshalb genommen werden, weil ihre Wirkung so angenehm ist. Deshalb trifft das Anliegen, Drogenprävention wieder mehr zu einer Aufgabe der Suchtprävention zu machen, nicht nur auf Ecstasy zu, sondern auch auf andere Substanzen. [...] Insofern meine ich ganz entschieden, daß ein Teilgebiet der Suchtprävention die Drogenaufklärung und Konsumberatung [...] sein sollte, die im Vorfeld von Sucht ansetzt und den gesundheitsgefährdenden Aspekten dieses Verhaltens in pragmatischer Weise entgegenwirkt
 .«
.«
Ich halte fest: Die Strategie der Drogenprävention der 70er Jahre beinhaltete einerseits die Information der Adressaten über biologische Abläufe im Körper, sowie die Vermittlung substanzspezifischer Kenntnisse (Stoffkunde bzw. Drogenkunde). Da diese Strategie jedoch nicht im Sinne einer sachlichen Drogenaufklärung umgesetzt wurde, man sie statt dessen in den Dienst der Abschreckung stellte, wurde sie von den Adressaten als offensichtlich unglaubwürdig und doppelmoralisch erlebt. Allerdings war die Drogenprävention der 70er nicht nur aus diesem Grund zum Scheitern verurteilt: Ein weiterer Grund bestand darin, daß man sich erhofft hatte, mit ihrer Hilfe das aus heutiger Sicht fragwürdige und völlig unrealistische Ziel weitgehendster Abstinenz innerhalb der Bevölkerung zu erreichen. Als sich herausstellte, daß die Strategie Drogenprävention nicht in der Lage sein würde, diesen Beitrag zu leisten, wurde sie wieder stark in den Hintergrund präventiver Arbeit gedrängt, wenn nicht gar verworfen. Aus heutiger Sicht jedoch erscheint es unter den folgenden Bedingungen wieder sinnvoll, daß Drogenprävention im Sinne substanzspezifischer Aufklärung zumindest ein Teilgebiet der gesamten präventiven Arbeit bildet: Wenn man sich zum einen bescheidener und vor allem realistischer gibt, also anstelle des Maximalziels Abstinenz andere berechtigte Ziele wie Gefahrenminimierung und Riskokompetenz fokussiert, zum anderen dafür sorgt, daß die zu leistende Drogenaufklärung den Namen Aufklärung im Sinne der Vermittlung sachlicher Informationen tatsächlich verdient. Ebenso wie Püschel betrachtet es auch Franzkowiak außerdem als sinnvoll, die reine substanzspezifische Aufklärung auf das Angebot der Konsumberatung auszuweiten. Seiner Meinung nach muß eine neue präventive Aufklärungsarbeit, um sich aus den Fallen der Abstinenzdogmatik lösen zu können, u.a. zwei Schwerpunkte haben:
Vermittlung lebensweltnaher Präventionsbotschaften, explizites und wahrheitsgemäßes Sprechen über Drogenwirkungen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen;
Verbraucherschutz durch substanzbezogene Aufklärung und Konsumberatung, durch Safer use und Safer sex- Verhaltensweisen
 .
.5. 2 Suchtprävention / Suchtprophylaxe Anfang der 80er Jahre kam es zu einem konzeptionellen und praktischen Wandel der suchtpräventiven Arbeit. Die als wenig erfolgreich angesehene Drogenprävention wurde im Zuge einer Neubesinnung vom substanzunspezifischen Leitkonzept der »Suchtprävention« abgelöst. Für meine Zwecke im Prinzip ausreichend ist die Feststellung, daß auch dieses Konzept weiterhin energisch am Maximalziel der Abstinenz festhielt. Der Gebrauch illegalisierter Drogen blieb weiterhin ein Tabu, weshalb in der präventiven Arbeit Maßnahmen wie z.B. der Konsumberatung zur Förderung der Risikokompetenz im Umgang mit Drogen kein Platz eingeräumt wurde. Auch Drug-Checking wäre zum damaligen Zeitpunkt noch undenkbar gewesen. Das scheinbar einzig akzeptable Konsumverhalten in bezug auf die illegalisierten Drogen blieb die Abstinenz. Es ist dennoch wichtig festzuhalten, daß im Zentrum des Leitkonzepts »Suchtprävention« die inzwischen gewachsene Einsicht stand, daß nicht die Drogen allein die Suchtgefährdung ausmachen. Vielmehr war man nun der Ansicht, das Suchtgefährdungspotential setze sich aus einem Ursachenbündel zusammen, das aus den psychosozialen, gesellschaftlichen, pharmakologischen und genetischen Bedingungen besteht, in und mit denen ein Mensch lebt
 . Die Grundsatzkritik an Ideologie und Methoden der Drogenprävention richtete sich gerade darauf, daß diese zu eingeschränkt auf die einzelnen Substanzen/Drogen und die mit ihnen assoziierten
Gefahren bezogen gewesen sei. Darüber hinaus habe man versäumt, »... die Lebenszusammenhänge von Jugendlichen, ihre Alltagsbelastungen und Entwicklungsherausforderungen angemessen zur Kenntnis zu nehmen bzw. in die Begründung präventiver
Arbeit einzubeziehen
. Die Grundsatzkritik an Ideologie und Methoden der Drogenprävention richtete sich gerade darauf, daß diese zu eingeschränkt auf die einzelnen Substanzen/Drogen und die mit ihnen assoziierten
Gefahren bezogen gewesen sei. Darüber hinaus habe man versäumt, »... die Lebenszusammenhänge von Jugendlichen, ihre Alltagsbelastungen und Entwicklungsherausforderungen angemessen zur Kenntnis zu nehmen bzw. in die Begründung präventiver
Arbeit einzubeziehen  .«
.«Im Mittelpunkt sollte fortan nicht mehr hauptsächlich der stoffliche Bereich, d.h. die Drogen, sondern vor allem der nicht-stoffliche Bereich stehen, also der Bereich, in dem man nun die »wahren« Ursachen von Suchtgefährdung und Abhängigkeitsentwicklung zu lokalisieren meinte. »Suchtvorbeugung hat nun den Anspruch, die hinter Rauschmittelkonsum, -mißbrauch und Drogenabhängigkeit liegenden Haltungen, Einstellungen, Entwicklungserfahrungen und -belastungen von Kindern und Jugendlichen zu erkennen und da, wo Brüche und Überforderungen drohen oder ein Scheiternvorgezeichnet scheint, soll präventiv eingegriffen werden
 .« Zu den Strategien der neuen suchtpräventiven Praxis zählt(e)
nun die eher unspezifische, generalpräventive Persönlichkeits- und Entwicklungsförderung bei Kindern und Jugendlichen. »Man hofft(e), durch allgemeine Kompetenzförderung dem komplexen Ursachenbündel für Suchtgefährdung [...] frühzeitig
immunisierend entgegenzuwirken
.« Zu den Strategien der neuen suchtpräventiven Praxis zählt(e)
nun die eher unspezifische, generalpräventive Persönlichkeits- und Entwicklungsförderung bei Kindern und Jugendlichen. »Man hofft(e), durch allgemeine Kompetenzförderung dem komplexen Ursachenbündel für Suchtgefährdung [...] frühzeitig
immunisierend entgegenzuwirken  .«
.«5. 3 Entwicklungs- und Gesundheitsförderung Mit Beginn der 90er Jahre entwickelte sich, auf der Grundlage zweier von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Auftrag gegebener »Expertisen zur Primärprävention des Substanzmißbrauchs«, ein weiteres Leitkonzept der präventiven Arbeit, von Franzkowiak als Phase der »Entwicklungs- und Gesundheitsförderung« bezeichnet.
In den Expertisen wurden die Erfahrungen von über 500 suchtpräventiven Studien und Projekten der neueren empirischen Literatur seit 1980 mit dem Ziel ausgewertet, »die aktuellen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Primärprävention herauszuarbeiten und Schlußfolgerungen und Vorschläge für erfolgreiche präventive Strategien zu entwickeln
 .« Als Ergebnis brachten die Expertisen hervor, daß insbesondere stark verhaltenstherapeutisch geprägte »Immunisierungsansätze«
präventiv wirksam seien. Hierunter zu verstehen sind bereits in der Kindheit ansetzende Individual- und Gruppentrainings, die zum einen die Stärkung der persönlichen und situativen »Standfestigkeit« (Standfestigkeitstraining, Entwicklung
sog. »resistance skills) gegenüber Drogen zum Ziel haben, wobei u.a. das Training des Widerstands gegen soziale Beeinflussung (Gruppendruck, Massenmedien) eine wichtige Rolle spielt. Zum
anderen sehen die Individual- und Gruppentrainings im Rahmen des sog. »Lebenskompetenzmodells« die Förderung allgemeiner »Lebenskompetenzen« (sog. life skills) zur besseren Bewältigung von Entwicklungsaufgaben vor. Aus
pädagogisch-psychologischer Sicht haben folgende Lebenskompetenzen (life skills) besonderen Wert und stehen deshalb im Mittelpunkt der Trainings: Es geht um die Vermittlung von allgemeinen (Streß-) Bewältigungsfertigkeiten, um die Entwicklung von
Selbstsicherheit bzw. Selbstwertförderung , um die Vermittlung geeigneter Konfliktlösungsstrategien, sowie um die Entwicklung sozialer Kompetenzen, so z.B. die Fähigkeit zu konstruktiver Konfliktregelung oder zum Widerstand gegen Gruppendruck. Franzkowiak
äußert sich jedoch auch kritisch zu der stark verhaltenstheoretischen Ausrichtung der »life skills« bzw. »resistance skills« - Trainings:
.« Als Ergebnis brachten die Expertisen hervor, daß insbesondere stark verhaltenstherapeutisch geprägte »Immunisierungsansätze«
präventiv wirksam seien. Hierunter zu verstehen sind bereits in der Kindheit ansetzende Individual- und Gruppentrainings, die zum einen die Stärkung der persönlichen und situativen »Standfestigkeit« (Standfestigkeitstraining, Entwicklung
sog. »resistance skills) gegenüber Drogen zum Ziel haben, wobei u.a. das Training des Widerstands gegen soziale Beeinflussung (Gruppendruck, Massenmedien) eine wichtige Rolle spielt. Zum
anderen sehen die Individual- und Gruppentrainings im Rahmen des sog. »Lebenskompetenzmodells« die Förderung allgemeiner »Lebenskompetenzen« (sog. life skills) zur besseren Bewältigung von Entwicklungsaufgaben vor. Aus
pädagogisch-psychologischer Sicht haben folgende Lebenskompetenzen (life skills) besonderen Wert und stehen deshalb im Mittelpunkt der Trainings: Es geht um die Vermittlung von allgemeinen (Streß-) Bewältigungsfertigkeiten, um die Entwicklung von
Selbstsicherheit bzw. Selbstwertförderung , um die Vermittlung geeigneter Konfliktlösungsstrategien, sowie um die Entwicklung sozialer Kompetenzen, so z.B. die Fähigkeit zu konstruktiver Konfliktregelung oder zum Widerstand gegen Gruppendruck. Franzkowiak
äußert sich jedoch auch kritisch zu der stark verhaltenstheoretischen Ausrichtung der »life skills« bzw. »resistance skills« - Trainings:»Nach solchen Einstiegserfolgen scheinen jedoch die meisten »life skills« - Trainings bereits mittelfristig ihren Effekt zu verlieren; das gilt v.a., wenn das Programm keine zusätzlichen, länger anhaltenden boostersessions (d.h. Auffrischungs-Elemente) enthielt. Konsequent weitergedacht führen die life skills-Ansätze in der vorliegenden Form zur äußerst problematischen »Notwendigkeit« einer langfristig angelegten, die späte Kindheit und das gesamte Jugendalter durchziehenden, »präventiven Dauer- bzw. Zwangstherapie« bei Millionen von Heranwachsenden
 .«
.«
Von solchen Einwänden unbeeindruckt, entwickelte die BZgA auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse ihre nationale Präventionsstrategie mit dem programmatischen Slogan »Kinder stark machen / Stark statt süchtig«, der die neue Ausrichtung der Suchtprävention der 90er Jahre anzeigte: Frühzeitige Immunisierung gegen Suchthaltungen und Kontakt mit allen Drogen durch die Förderung von Standfestigkeits- und Lebenskompetenzen.
»Die Suchtprävention der 90er Jahre zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern und andere pädagogische Bezugspersonen so zu unterstützen bzw. zu befähigen, daß sie konstruktiv mit Entwicklungsbelastungen, Benachteiligungen und Überforderungen fertig werden. Ängste oder Versagenserlebnisse, aber auch die legitime Suche nach Spaß, Aufregung und 'Kicks', sollen ohne den Griff zu Drogen oder die Wahl anderer Risikomuster bewältigt werden können
 .«
.«
Konkreter ging es um die Förderung von Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen, die sie vor der Gefahr der Entwicklung eines Mißbrauchs- und Suchtverhalten schützen sollten
 . Den Untersuchungsergebnissen entsprechend waren die wichtigsten Bereiche in diesem Zusammenhang:
. Den Untersuchungsergebnissen entsprechend waren die wichtigsten Bereiche in diesem Zusammenhang:- Die Unterstützung bei der Suche nach Sinnerfüllung
- Die Förderung der Eigenverantwortung
- Die Förderung der Eigenaktivität
- Die Förderung der Handlungskompetenz
- Die Förderung der Selbstachtung
- Die Förderung der Erlebnisfähigkeit
- Die Förderung von Konfliktfähigkeit
- Die Förderung von Frustrationstoleranz
Als äußerst kritisch betrachtet werden muß die Tatsache, daß die Maßnahmen der Suchtprävention auch während der als »Entwicklungs- und Gesundheitsförderung« bezeichneten Phase der 90er Jahre auf Kosten ihrer Glaubwürdigkeit und damit auch Effektivität weitgehendst vom Abstinenzdogma bestimmt blieben. Kampagnen wie die der BZgA (»Kinder stark machen« - zu stark für Drogen; »Starke« Kinder können von sich aus »Nein« sagen; Schlimm genug, daß es Drogen gibt, aber das allein macht nicht süchtig) tabuisieren die Möglichkeit eines genußvollen Umgangs mit Drogen bzw. die positiven Aspekte des Drogenkonsums und setzen diesen in suggestiver Weise mit Drogenabhängigkeit gleich. Das drogeninduzierte Erlebnis von Rausch, höchstem Glück, Ekstase, Lust und Genuß bleibt weiterhin ein Tabu, der Griff vor allem zu den illegalisierten Drogen muß - für viele Jugendlichen unverständlich - unbedingt vermieden werden. Zur ausführlicheren Kritik am Abstinenzparadigma der Präventionsarbeit komme ich weiter unten.
Immerhin theoretisch wurde jedoch in dieser dritten Konzeptphase der Suchtprävention dem traditionellen Maximalziel einer grundsätzlichen Verhinderung von Drogenkonsum erstmals das Realziel »Verhinderung eines längerfristigen Mißbrauchsverhaltens« zur Seite gestellt, wobei ich hier nochmals betonen möchte, daß in diesem Zusammenhang auch der ganz »normale«, gelegentliche Gebrauch der illegalisierten Drogen grundsätzlich als Mißbrauch angesehen wird. Als Teilaspekte dieses Realziels wurden formuliert:
- Aufschub von Konsum- und Probierbeginn bei legalen und vor allem illegalisierten Drogen;
- Beschränkung von substanzbezogenem Ge- und Mißbrauch auf einen experimentellen, zeitlich kurzfristigen Probierkonsum;
- Verhinderung von Abhängigkeitsentwicklungen bei dauerhaftem Mißbrauch durch Ermöglichung eines kontrollierten Konsums;
- Gleichzeitige Einwirkung auf negative Sozialisations- bzw. Milieubedingungen von gefährdeten und suchtaffinen Jugendlichen
 .
.
Wie bereits angedeutet, hat diese Reformulierung von präventiven Zielen tatsächlich allerdings die suchtpräventive Praxis nicht in nennenswerter Weise verändert. Von einer Aufgeschlossenheit dem experimentellen und kurzfristigen Probierkonsum gegenüber kann keine Rede sein. Die angeblich angestrebte Ermöglichung eines kontrollierten Konsums wird schon durch die ungünstigen Bedingungen des Schwarzmarktes verhindert, denen man in kaum einer geeigneten Weise entgegensteuert. Franzkowiak kommentiert dies so: »Geht es um drogenbezogenes Handeln und den konkreten Umgang mit legalen wie illegalen Rauschmitteln, werden alle drogenunspezifischen »Lebenskompetenzen« umgehend und äußerst traditionell rückgeführt auf »resistance skills« – also auf die Einforderung von substanzbezogener Abstinenz durch Verhaltenstraining mit dem Ziel der Standfestigkeit
 .«
.« Derzeit scheint die Präventionsarbeit der Drogenhilfe jedoch in eine entscheidende neue Phase zu treten. Neben der zunehmenden Kritik am die bisherigen Präventionsmodelle beherrschenden Abstinenzdogma, sind es vor allem die Erkenntnisse der Jugendrisikoforschung, die eine Neugewichtung und Erweiterung der bisherigen präventiven Zielsetzungen inklusive bedeutsamer Veränderungen in der Praxis dringend notwendig erscheinen lassen. Die Neugewichtung und Erweiterung präventiver Zielsetzungen sieht so aus, daß die Abstinenzforderung drastisch an Bedeutung verliert, während nun als neue Strategie die Förderung sogenannter Risikokompetenz bei Jugendlichen und jungen Heranwachsenden zum zentralen Anliegen der Präventionsarbeit wird:
5. 4 Jugendrisikoforschung und die Konsequenzen für
die Prävention: Entwicklungspsychologisch und sozialisationstheoretisch wird heute die Jugendphase immer weniger als geschützter (Zeit- und Schon-)Raum vor der Übernahme von Erwachsenenrollen angesehen, sondern als Lebensphase mit eigenständigen Handlungsanforderungen (Entwicklungsaufgaben), zu deren Bewältigung stets das Eingehen von Risiken auch eine gewisse Rolle spielt. In der neueren Forschung zum Drogenkonsum wurde das sog. »Risikoverhalten« daher zum neuen Leitbegriff. Drogenkonsum und -mißbrauch in der Jugendphase wird nun als Ausdruck jugendtypischen Risikoverhaltens begriffen und unter diesem Aspekt auch untersucht:
»Unter Risikoverhalten verstehen die Gesundheits- und Entwicklungswissenschaften den Ge- und Mißbrauch von legalen und illegalen Drogen, die nicht-bestimmungsgemäße Anwendung von Medikamenten, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit unbekannten bzw. wechselnden Partnern sowie die Herbeiführung körperlicher, seelischer und sozialer Extremerfahrungen mit dem kurz- bzw. langfristigen Risiko, die jeweils gegebene relative körperliche bzw. psychosoziale Gesundheit [...] zu gefährden. [...] Als isoliertes Ereignis ist Risikoverhalten subjektiv wie objektiv in den meisten Fällen nicht mit direkt erlebbarer oder irreversibler Schädigung verbunden [...] . Erst mit einer kontinuierlichen und längerfristigen Ausübung und Gewöhnung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Entstehung chronisch-degenerativer Erkrankungen, der Suchtgefährdung und Abhängigkeitsentwicklung, der potentiellen Schädigung durch Unfälle, einer möglichen HIV-Infektion etc
 .«
.«
Aus der Sicht von Peter Franzkowiak läßt sich: »Risikoverhalten [...] als ein entwicklungsbegleitendes, mit subjektivem und kollektivem Nutzen aufgeladenes Handeln entziffern. Es besitzt sozial und (sub-)kulturell integrierenden Charakter und zeichnet sich durch eine vielfache Funktionalität aus. Es kann im Rahmen der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und der Identitätsbildung eingesetzt werden und dient als gemeinschaftlich akzeptiertes Accessoire in den vielfältigen Initiations- und Übergangsriten der Jugendphase. Da es in der Regel mit dem Erleben von Thrill und der Suche nach alltagstranszendierenden Kicks verbunden ist, kann es neben der Problemkompensation auch Funktionen der Grenzerfahrung bis hin zu einer, in der Regel nur kurzfristigen und begrenzten, Grenzüberschreitung erfüllen. Risikoverhalten kann zweifellos den Einstieg in eine irreversible Selbstschädigung, in Suchtgefährdung oder Delinquenz markieren, muß aber nicht unbedingt dazu führen. Eher gehört es, im Rahmen der Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben, als Durchgangsstation zur normalen Entwicklung zwischen Pubertät, Rollenauseinandersetzung, Identitätsbildung, Berufseintritt und Sexualität/Partnerbindung
 .«
.«Laut Franzkowiak ist also das Risikoverhalten, im Rahmen der Identitätsbildung sowie der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, im mehrfachen Sinne von subjektivem Nutzen. Der Risikonutzen bzw. die Funktionsvielfalt von Risikoverhalten läßt sich grob wie folgt unterteilen:
- Statushandlung und Stilbildung (Risikoverhalten als symbolischer, demonstrativer Vorgriff auf das Erwachsensein, als Initiationsritus)
- Konformitätsübung und Bewährungsprobe (Risikoverhalten zur Anerkennung in zugänglichen oder angestrebten Peer-Bezugsgruppen)
- Bewältigungsversuch (Risikoverhalten zum stellvertretenden Fertigwerden mit subjektiv unlösbarem Entwicklungsstreß, zur kurzfristigen Bewältigung von Ängsten oder Versagenserlebnissen)
- Kompensation und Betäubungsversuch (Risikoverhalten als Ausweichhandlung)
- Eingehen »kleiner Fluchten« und abenteuerlicher Wagnisse (Risikoverhalten als Medium einer aktiven, zielgerichteten kurz- und mittelfristigen Bewußtseinsveränderung oder Grenzerfahrung)
 .
.
Die Risikoforschung sieht im Drogenkonsum Jugendlicher eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Erwachsensein. Es ist ein zur normalen Entwicklung des Jugendlichen hinzugehöriges, in der Regel vorübergehendes Phänomen mit breitgefächerter Funktionalität. Sobald dieses experimentelle Entwicklungsstadium abgeschlossen ist, wird der Drogenkonsum eingestellt bzw. reduziert. Bei der Entwicklung präventiver Strategien ist es deshalb überaus wichtig, »Probier-, Gelegenheits- und Gewohnheitskonsum« nicht gemeinsam mit dem Phänomen des »Problemkonsums« in einen Topf zu werfen. Problematische Konsummuster, die außerdem weit über die Jugendphase hinaus anhalten, haben vorrangig mit nachteiligen persönlichen, familiären und milieubedingten Kindheitserfahrungen zu tun. Keinesfalls aber sind sie den Substanzen allein bzw. einem jugendtypischen Probier- oder Gelegenheitskonsum zuzuschreiben. Erkenntnisse dieser Art führten zu einer Neubewertung des jugendlichen Umgangs mit Drogen. Insbesondere gerät das Abstinenzdogma der (primären) Suchtprävention in die Kritik, da der Drogenkonsum im Jugendalter nun als normale, funktionale Erscheinungsform dieser Lebensphase angesehen wird. Drogenkonsum erweist sich lediglich als eine mögliche Ausdrucksform von Risikoverhalten, welches offensichtlich eine übliche Erscheinungsform im Entwicklungsprozeß der Jugendphase darstellt. Die präventive Zielsetzung der Abstinenz bzw. des »Einfach-Nein-Sagens« erweist sich nun eindeutig als zu verkürzt. Vor dem Hintergrund, daß die Jugendphase immer auch eine Zeit des Risikoverhaltens darstellt, wird der Erwerb von »Risikokompetenz« im Zusammenhang mit Drogenkonsum als neu entdeckte, von der Suchtprävention zu unterstützende unumgängliche Entwicklungsaufgabe des Jugendlichen angesehen. Es gilt, die Eigenverantwortlichkeit des Jugendlichen im Umgang mit Drogen zu stärken, d.h. seine Drogenmündigkeit zu fördern.

Fußnoten:
- Robert Ardrey, zit. in: Paul Watzlawick, John H. Weakland, Richard Fisch: Lösungen. Bern ; Göttingen ; Toronto 1992, 69
 .
. - Konfuzius, zit. in: P. Watzlawick, J.H. Weakland, R. Fisch, a.a.O., 99
 .
. - Die nachfolgenden Ausführungen, das Kapitel 6 »Von der Drogenprävention zur Drogenmündigkeit« betreffend, beziehen sich auf nachfolgend genannte Literatur, sofern nicht anders angegeben:
- Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.): Suchtprävention. Freiburg i. Br. 1994, 38-49.
- Heino Stöver (Hrsg.): Akzeptierende Drogenarbeit. Freiburg im Breisgau 1999, 57-74.
- Akzept e.V. (Hrsg.): Akzeptanz - Zeitschrift für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik 2/98, 6. Jahrgang, 4-22.
- H. Schlömer in: Akzept e.V. (Hrsg.): Menschenwürde in der Drogenpolitik. Hamburg 1993, 186-196
 .
. - Vgl. H. Schlömer, a.a.O., 186-195
 .
. - H. Schlömer, a.a.O., 188f
 .
. - Sebastian Scheerer: RORORO Special: Sucht. Reinbek bei Hamburg 1995, 100
 .
. - H. Schlömer, a.a.O., 187
 .
. - Eine ausführliche Erläuterung des Begriffs »Risikokompetenz« erfolgt in einem späteren Abschnitt dieses Kapitels
 .
. - Monika Püschl, in: M. Rabes / W. Harm (Hrsg.), a.a.o., 210f
 .
. - Vgl. H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 71
 .
. - Vgl. M. Rabes / W. Harm (Hrsg.), a.a.O., 207
 .
. - H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 59
 .
. - H. Stöver (Hrsg.), ebd
 .
. - H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 60
 .
. - Elisabeth Pott in: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.), a.a.O., 44
 .
. - Peter Franzkowiak in: akzept e.V. (Hrsg.): Akzeptanz - Zeitschrift für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitk, 2/98 6. Jahrgang, 7
 .
. - P. Franzkowiak in: akzept e.V. (Hrsg.): a.a.O., 7
 .
. - Anzumerken ist hier, daß zu dieser Zeit im Bereich der Prävention nach wie vor der ganz normale Gebrauch der illegalisierten Drogen
automatisch mit Mißbrauch gleichgesetzt wurde, eine differenziertere Betrachtung des Drogenkonsums in Theorie und Praxis
der Präventionsarbeit also weiterhin kaum eine Rolle spielte
 .
. - Vgl. H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 66
 .
. - P. Franzkowiak in: akzept e.V. (Hrsg.): a.a.O., 9
 .
. - H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 62
 .
. - H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 63
 .
. - Vgl. H. Stöver (Hrsg.), a.a.O., 63
 .
.
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
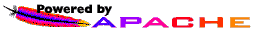

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |

