Drug-Checking in den NiederlandenErgebnisse einer Informationsreise von Eve & Rave
Besprechungsprotokoll der Arbeitssitzung mit Roel Kerssemakers im Jellinekzentrum in Amsterdam am 17. März 1995.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droge |
1993 |
1994 |
| Kokain |
3 %
|
2 %
|
| Ecstasy |
4 %
|
4 %
|
| Speed |
2 %
|
2 %
|
| LSD |
1 %
|
1 %
|
| Heroin |
0 %
|
0 %
|
| Valium |
1 %
|
1 %
|
| Schnüffelstoffe |
0 %
|
1 %
|
| Poppers |
1 %
|
1 %
|
Es scheint mir hier bemerkenswert, daß der Gebrauch von Heroin bei den Schülern und Lehrlingen in Amsterdam auf Null gesunken ist. Hier zeigt sich deutlich, daß die Drogenpolitik und die Präventionsarbeit erfolgreich sind und ihre Früchte tragen. Roel Kerssemakers freute sich sichtlich, als er uns von den Ergebnissen der Antenne-Untersuchungen berichtete, insbesondere, weil die Niederländer wegen ihrer Drogenpolitik von den Nachbarstaaten oft kritisiert werden und zuweilen sogar übel beschimpft. Doch hier zeigt sich, das der niederländische Weg, was die Drogenprävention und Drogenpolitik anbelangt, eine Botschaft vermittelt und beinhaltet, die bei ambivalenten und gefährdeten Personenkreise auf offene Ohren trifft.
Die Gewohnheiten der Coffeeshopbesucher
Im Zentrum von Amsterdam wurden 50 Coffeeshops ausgesucht und dort Besucher unter 25 Jahren nach ihren Gewohnheiten befragt, wobei ausländische Touristen in dieser Befragung nicht einbezogen wurden. Insgesamt wurden dann 142 Fragebogen ausgewertet. Besucher von Coffeeshops unterscheiden sich in einigen Punkten ganz wesentlich von den durchschnittlichen Schülern und Lehrlingen.
Die folgende Tabelle zeigt die auffälligsten Unterschiede bezüglich des Drogenkonsums zwischen den typischen Besuchern von Coffeeshops und den Lehrlingen. In der 1. Spalte ist die jeweilige Droge aufgeführt, in der 2. Spalte der Prozentsatz der Besucher von Coffeeshops, die diese Droge nehmen, in der 3. Spalte der entsprechende Prozentsatz bei den Schülern und Lehrlingen und in der 4. Spalte die entsprechende Differenz (Zahlen für 1994).
Droge |
Coffeeshop- Besucher |
Schüler und Lehrlinge |
Differenz |
Alkohol |
|
||
|
gelegentlich
|
64 %
|
63 %
|
+1 %
|
|
täglich
|
15 %
|
2 %
|
+13 %
|
Tabak |
|
||
|
gelegentlich
|
9 %
|
13 %
|
-4 %
|
|
täglich
|
66 %
|
25 %
|
+41 %
|
Haschisch |
|
||
|
gelegentlich
|
19 %
|
13 %
|
+6 %
|
|
täglich
|
59 %
|
3 %
|
+56 %
|
Mindestens einmal im Jahr 1994 haben gebraucht:
Droge |
Coffeeshop- Besucher |
Schüler und Lehrlinge |
Differenz |
|
Kokain
|
28 %
|
2 %
|
+26 %
|
|
Ecstasy
|
39 %
|
4 %
|
+35 %
|
|
Speed
|
7 %
|
5 %
|
+2 %
|
|
LSD
|
4 %
|
1 %
|
+3 %
|
|
Heroin
|
0 %
|
0 %
|
+/-0 %
|
|
Valium
|
1 %
|
1 %
|
+/-0 %
|
|
Schnüffelstoffe
|
0 %
|
1 %
|
-1 %
|
|
Poppers
|
2 %
|
1 %
|
+1 %
|
Coffeeshops sind Treffpunkte für Gras- und Haschischraucher und werden von den Usern als solche akzeptiert. 19% der Besucher sind gelegentliche, 59% tägliche Konsumenten, zusammen sind das 78%.
Coffeeshops sind in erster Linie für Haschischraucher eingerichtet, damit sie dort ihr Gras und ihr Haschisch kaufen können und der Handel mit Cannabisprodukten normalisiert und reguliert werden kann. So sind die Haschischgebraucher nicht genötigt, zu einem Dealer zu gehen, der vielleicht in einem kriminellen Milieu arbeitet, sondern können ihre Ware ganz normal kaufen.
Nach Haschisch (78%) sind Tabak (75%), Ecstasy (39%) und Kokain (28%) die am häufigsten konsumierten Drogen, abgesehen vom Alkohol, der mit 79% den Spitzenplatz Nr. 1 belegt (In Coffeeshops wird kein Alkohol verkauft oder ausgeschenkt).
Bei allen anderen Drogen gibt es im Verbraucherverhalten und der Beliebtheit keinen großen Unterschied zwischen den Coffeeshopbesuchern und den durchschnittlichen Schülern und Lehrlingen. Heroin wird in den Coffeeshops nicht konsumiert. Keiner der befragten hatte innerhalb des letzten Jahres Heroin konsumiert. Heroin ist in Holland out!
Panel-Technik in Amsterdam
Panel-Technik ist eine Methode der Meinungsforschung, die gleiche Gruppe von Personen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes mehrfach zu ein und derselben Sache zu befragen. Das Wort ist vom griechischen Ausdruck pañ abgeleitet. Pañ bedeutet soviel wie "ganz, all, jeder". Die Vorsilbe kommt auch in den Wörtern Panoptikum oder auch Panorama vor. Die Panel-Technik dient dazu, daß man stets über die neuesten Trends informiert ist und vor allem deren Ursachen kennt.
Informationen aus der Drogenszene
Da in den Niederlanden die Drogenpolitik bei weitem nicht so repressiv gehandhabt wird, wie in den Nachbarländern und der Staat den Usern eine große Palette an Dienstleistungen anbietet, ist das Verhältnis zwischen Staat und den Drogengebrauchern viel entspannter als in den Nachbarländern. So ist auch die Bereitschaft bei den Drogengebrauchern viel größer, über ihren eigenen Drogengebrauch zu reden und von den Erfahrungen und Erlebnissen zu erzählen.
Das Jellinek-Institut schickt zweimal pro Jahr etwa 25 Mitarbeiter in die Stadt, um in einschlägigen Kreisen nach den neuesten Trends zu forschen. Die Interviewer und die befragten Personen kennen sich zum Teil seit vielen Jahren und haben ein vertrauliches Verhältnis zueinander. Es ist natürlich selbstverständlich, daß alle Angaben vertraulich behandelt werden und daß niemand ein polizeiliches oder juristisches Nachspiel befürchten muß!
Andere Staaten wissen vor allem durch polizeiliche Ermittlungen, was in ihrer Drogenszene vor sich geht, doch ist auch klar, daß Angaben, die Personen gegenüber den Ermittlungsbehörden machen, mit Vorsicht zu genießen sind und wahrlich nicht immer der Wahrheit entsprechen. Roel Kerssemakers betonte auch, daß es für ihn befremdlich ist, daß viele ausländische Politiker den Drogenkonsumenten eine Flucht vor der Realität vorwerfen, doch sie selbst wollen die Realität, daß Drogen in ihrem Zuständigkeitsbereich konsumiert werden, nicht anerkennen. Sie träumen von einer sogenannten drogenfreien Gesellschaft (wobei Alkohol, Nikotin und diverse Tabletten als Quantité négligeable aus der Doktrin verdrängt werden) und merken nicht, daß sie damit selbst eine Realitätsflucht begehen.
Mittels der Panel-Technik können stets die neuesten Trends in der Drogenszene aufgespürt werden und man kann sofort beginnen, Konzepte zu entwickeln, wie man gefährlichen Trends entgegenwirken kann. Oft handelt es sich auch nicht um reine drogenpolitische Konzepte, sondern um soziale und/oder kulturelle Fragen. So sind Coffeeshops nicht nur Treffpunkte für Drogengebraucher, sondern auch Zentren, in denen zuweilen heftig über Sozialpolitik und Kultur gesprochen wird. Die Gespräche entstehen automatisch im Verlaufe der Befragungen im Rahmen des Panel-Systems. Die Ergebnisse der Gespräche werden dann im Jellinek-Institut ausgewertet und in der Vierteljahreszeitschrift "Jellinek Quarterly", die in Niederländisch, Englisch und Deutsch erscheint, publiziert.
Streetworker
Das Jellinek-Institut beschäftigt insgesamt etwa 500 Personen, wobei die meisten in der Klinik für Suchttherapie arbeiten. Dann hat das Institut verschiedene Außenstellen mit diversen Serviceleistungen für Personen, die an Suchtkrankheiten leiden und zu gefährdeten Kreisen gehören. Des weiteren arbeiten in Amsterdam auch eine Gruppe Streetworker im einschlägigen Drogenmilieu. Die Streetworker bieten persönliche Hilfe vor Ort an, vermitteln diverse Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich und erfahren durch persönliche und vertrauliche Gespräche viel über die Hintergründe bezüglich der Einnahme verschiedenster Drogen. Die Streetworker sind also einerseits Helfer, anderseits auch Antennen zur Feststellung neuer Trends.
Klienten im Zentrum
Im Zentrum von Amsterdam hat das Jellinekzentrum ein Informations- und Beratungszentrum. Dort arbeiten 5 Personen, die den Besuchern mit Rat und Tat beizustehen versuchen. Hier werden nicht nur Aufklärungsmaterialien verteilt und Gespräche geführt, sondern man kann auch Drogen testen lassen.
Der Pillentest ist im Jellinekzentrum gratis. Man gibt seine Pille ab, bekommt einen Code und kann dann etwa eine Woche später erfahren, was in der Pille war. Man erhält eine qualitative wie auch eine quantitative chemische Analyse. Pillentests sind eine prophylaktische Maßnahme und dienen vor allem der Prävention von Unfällen im Rahmen des Drogengebrauchs. Des weiteren dienen die Pillentests dem Monitoring und sind für das Projekt Antenne verwendbar.
Roel Kerssemakers erzählte ein Beispiel. Es kam ein Dealer, der eine Tablette abgegeben hatte, im Glauben, es handle sich um Ecstasy. Der Test ergab jedoch, daß die Tablette 80 mg reines Amphetamin enthielt. Eine normale Wirkungsdosis dieses Amphetamins liegt jedoch zwischen 10 mg bis 20 mg. Der Dealer war nachher sehr erleichtert, daß er die Pille hat testen lassen, denn er hätte seine Kundschaft ganz schön vergrault, wenn er sie alle auf eine Überdosis Speed geschickt hätte. Zahlreiche MDMA-Gebraucher mögen nämlich kein Speed. Die Mitarbeiter waren auch erleichtert, denn mit Tabletten, die 80 mg Amphetamin enthalten, kann es leicht zu ernsthaften Problemen kommen, man stelle sich nur vor, jemand, der noch nie Speed konsumiert hat, nimmt gleich zwei oder drei solcher Tabletten ...
dieser Test hat vielleicht die gesundheitliche Unversehrtheit oder vielleicht sogar das Leben von Menschen gerettet!
Drug-Checking in den Niederlanden – Ergebnisse einer Informationsreise von »EVE & RAVE«
Die Besprechungszusammenfassungen der Gespräche mit August de Loor (Adviesburo Drugs Amsterdam) und mit Roel Kerssemakers (Jellinek Institut Amsterdam) sowie das Interview mit Erik Fromberg (wissenschaftlicher Leiter des N.I.A.D. Nederlands Instituut voor Alkohol en Drugs) im März 1995 sind seit April 1995 in gedruckter Form (Photokopien, 26 Seiten) bei EVE & RAVE e.V. Berlin erhältlich. Bis zum Sommer 2000 wurden mehr als 1300 Kopien angefordert und verschickt, respektive an Informationsständen abgegeben.
| [zurück] | [Inhalt] |
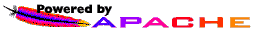

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |