Drug-Checking-Konzeptfür die Bundesrepublik Deutschland
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
Drug-Checking-Konzept für die Bundesrepublik Deutschland
Konzeptioneller Vorschlag
zur Organisation von
Drug-Checking
Eine Diskussionsgrundlage
-
Drogen – Wirkung, Gebrauch und Erfahrung
-
Außergewöhnliche Bewußtseinszustände
Trance und Ekstase sind außergewöhnliche Bewußtseinszustände, die durch Fasten und/oder spezielle Meditationstechniken (asketisches Induktionsmodell), aber eben auch durch Tanz und/oder Drogen (hedonistisches Induktionsmodell) induziert werden können. Zur Beschreibung der Erlebniswelten von außergewöhnlichen Bewußtseinszuständen hat sich in der experimentellen Psychologie wie auch in der psychiatrischen Forschung die Einteilung der beobachteten Phänomene in drei Dimensionen eingebürgert. Die erste Dimension ist die ozeanische Selbstentgrenzung (OSE) und beschreibt die angenehmen und beglückenden Aspekte der außergewöhnlichen Bewußtseinszustände wie die Erfahrung des Einsseins mit sich und der Welt. Die zweite Dimension beschreibt die angstvolle Ichauflösung (AIA), ein Erleben, das allgemein als Horrortrip oder Paranoia bezeichnet wird und die dritte Dimension, die visionäre Umstrukturierung (VUS), beschreibt die vielschichtigen Einzelaspekte der Veränderungen im Bereich der Wahrnehmung
 . Diese
drei Dimensionen können in Anlehnung an den mit entheogenen
Drogen erfahrenen Schriftsteller Aldous Huxley als Himmel,
Hölle und Vision interpretiert werden
. Diese
drei Dimensionen können in Anlehnung an den mit entheogenen
Drogen erfahrenen Schriftsteller Aldous Huxley als Himmel,
Hölle und Vision interpretiert werden  .
.Viele Drogenberater kennen vornehmlich die negativen Auswirkungen des Drogenkonsums, mit den positiven Aspekten haben sie sich zumeist nicht näher beschäftigt. Aus diesem (profanen) Stand des Wissens können jene Drogenberater jedoch kaum die tiefe Sehnsucht nach der "Realität" völlig entfremdeter Bewußtseinszustände umfassend ergründen, noch sind sie in der Lage, sich in die Erlebniswelten einzufühlen, in denen durch die Veränderung der gesamten kognitiven Funktionen (Wahrnehmung) das eigene Sein jenseits jeglicher Art von Abstraktion wahrgenommen wird. Diese oftmals in Trance- und Ekstasezuständen erlebte Veränderung der Wahrnehmung kann sich einerseits durch eine kaum faßbare, äußerst intensive Aktivierung und Sensibilisierung aller Sinnesorgane auszeichnen und anderseits lang vergessen geglaubte Bilder aus dem Erinnerungsvermögen in unglaublich klarer Plastizität ins Zentrum des Bewußtseins führen. Als ozeanische Selbstentgrenzung erlebt, sind diese Bilder beglückend, als angstvolle Ichauflösung durchlebt sind sie hingegen bedrückend.
Indikatoren für eine Prognose des Erlebens der angstvollen Ichauflösung aus der Perspektive eines außergewöhnlichen Bewußtseinszustandes sind im wesentlichen eine habituelle oder situative emotionale Labilität sowie eine starre Konventionalität, das heißt eine Abneigung gegen Ungewisses und Ungewohntes und ein starres Festhalten an Normen und Verpflichtungen. Die Angst vor allfälligen unangenehmen Erkenntnissen bezüglich der eigenen Person, die durch einen außergewöhnlichen Bewußtseinszustand offenbart werden könnten, und die Angst, daß durch das völlig fremdartige Erleben das ganze innere Bezugssystem, auf welches sich die Selbst- und Welterfahrung gründet, seine Gültigkeit verlieren könnte, diese Angst ist ein signifikanter Indikator für eine große Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer angstvollen Ichauflösung bei dem Versuch einen außergewöhnlichen Bewußtseinszustand zu induzieren.
Je rigider jemand ist, desto eher entwickelt jemand Angst. Der Begriff Rigidität (lat. rigere "starr sein, steif sein") bezeichnet in der empirischen Psychologie die mangelnde Fähigkeit eines Menschen, sich angesichts von Veränderungen der objektiven Bedingungen oder Voraussetzungen von einmal eingeschlagenen Denkmustern und gewohnten Handlungsweisen zu lösen und andere, der neuen Situation entsprechende und angemessene zu entwickeln und diese im Rahmen der veränderten Bedingungen umzusetzen. Der Rigiditätskoeffizient (Grad der geistigen Starrheit und Steifheit) eines Menschen ermöglicht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Aussage zu treffen, ob jemand in einer bestimmten Situation von Angstzuständen befallen wird und einen "Horrortrip" durchleben muß oder nicht. Je größer dieser Rigiditätskoeffizient ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Auftauchens von Horrorvisionen
 .
.Je stärker das dominierende Interesse der persönlichen Weltanschauung und Lebensphilosophie im theoretisch-ökonomischen Bereich liegt und je geringer dieses Interesse im sozialen Bereich ausgeprägt ist, desto größer scheint die Tendenz, daß der außergewöhnliche Bewußtseinszustand eine angstvolle Ichauflösung begünstigt. Im umgekehrten Fall, das heißt, je stärker das Interesse im sozialen Bereich ausgeprägt ist im Vergleich zum theoretisch-ökonomischen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Erlebens angenehmer Momente im Rahmen einer ozeanischen Selbstentgrenzung
 .
.Die angstvolle Ichauflösung ist eine von drei Dimensionen außergewöhnlicher Bewußtseinszustände. Angst ist besonders groß in einer Gesellschaft, in der Rationalität und Selbstbeherrschung übermäßig betont werden. Dies gilt besonders in Hinblick auf die Angst vor Kontrollverlust des Ichbewußtseins, vor der Ichauflösung – die gemäß transpersonaler Psychologie – zum wirklich spirituellen Weg gehört
 . Leidet nun jemand
unter der "Realität" völlig entfremdeter Bewußtseinszustände,
wie zum Beispiel an einer angstvollen Ichauflösung, dann kann
ein Arzt durch Verabreichung von Medikamenten zwar die Symptome
lindern, doch der eigentliche Kern des Problems wird dadurch nicht
berührt. Ein guter Berater hingegen, der selbst Erfahrungen
mit außergewöhnlichen Bewußtseinszuständen
gemacht hat, ist dadurch eher befähigt, hier helfend einzuwirken,
da er den Weg der visionären Umstrukturierung von der angstvollen
Ichauflösung in die Dimension der ozeanischen Selbstentgrenzung
selbst kennt und so eher die angenehmen und beglückenden Aspekte
dieser Dimension wie die Erfahrung des Einsseins mit sich und der
Welt vermitteln kann.
. Leidet nun jemand
unter der "Realität" völlig entfremdeter Bewußtseinszustände,
wie zum Beispiel an einer angstvollen Ichauflösung, dann kann
ein Arzt durch Verabreichung von Medikamenten zwar die Symptome
lindern, doch der eigentliche Kern des Problems wird dadurch nicht
berührt. Ein guter Berater hingegen, der selbst Erfahrungen
mit außergewöhnlichen Bewußtseinszuständen
gemacht hat, ist dadurch eher befähigt, hier helfend einzuwirken,
da er den Weg der visionären Umstrukturierung von der angstvollen
Ichauflösung in die Dimension der ozeanischen Selbstentgrenzung
selbst kennt und so eher die angenehmen und beglückenden Aspekte
dieser Dimension wie die Erfahrung des Einsseins mit sich und der
Welt vermitteln kann. -
Drogenarbeit zwischen Pharmakologie und Bewußtseinsforschung
Eine systematische Übersicht bezüglich der subjektiven Wirkungen psychoaktiver Substanzen und deren Klassifikation ist für das Verständnis der hier angesprochenen Thematik nicht nur hilfreich, sondern grundlegende Voraussetzung, wie sich in vielen Einzel- und Gruppengesprächen an Informationsständen von Eve & Rave anläßlich zahlreicher Parties zeigte. Je besser man in der Lage ist, bestimmte Erlebnisbereiche systematisch klar abgegrenzten Begriffen zuzuordnen, die gemäß ihrer Definition in logisch faßbare Strukturen verknüpft werden können, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Gespräch Angst- und Panikreaktionen oder auch paranoide Episoden aufzufangen und zu entdämonisieren.
Außer den drei oben beschriebenen Kategorien (OSE, AIA und VUS) zur Einteilung häufig beobachteter Phänomene außergewöhnlicher Bewußtseinszustände bürgerte sich in Fachkreisen zur Deskription von Drogenerfahrungen die Klassifikation der dominanten Rauscherlebnisse entsprechend den fünf folgenden Prägnanztypen ein:

- Psychotische Phänomene
Obwohl verschiedene Autoren sämtliche veränderte Bewußtseinszustände als "psychotisch" klassifizieren, sind hier lediglich Symptome wie paranoide Episoden, Angst- und Panikreaktionen, etc. einzuordnen.
- Psychodynamische Erfahrungen
Damit bezeichnet man unter anderem die sogenannte "age regression" mit Rekapitulation frühkindlicher (z.B. traumatischer) Erinnerungen und Reminiszenzen verdrängter Erlebnisse mit kathartischer Abreaktion, das heißt: ein sich Befreien von seelischen Konflikten und inneren Spannungen, eine emotionelle Abreaktion. Auf spiritueller Ebene bezeichnet man die kultische Reinigung (Läuterung) der Seele von (üblen) Leidenschaften als Katharsis.
- Ästhetische Erfahrungen
Das sind Erlebnisse gesteigerter Wahrnehmungen, zum Beispiel das Erleben von Farbhalluzinationen mit überwältigender Schönheit oder auch synästhetische Wahrnehmungen die beim Hören von Musik tiefe ästhetisch emotionale Regungen hervorrufen.
- Kognitive Erfahrungen
Dieser Bereich umfaßt die Erfahrungen bezüglich der Wahrnehmung des eigenen Selbst und der Umwelt aus völlig neuen Perspektiven.
- "Transzendente" respektive psychedelische Erfahrungen
Hierzu gehören die Seele erhellende Erfahrungen bedingt durch das Alltagsbewußtsein transzendierende Erlebnisse. Werden solche transzendentale Erlebnisse vorsätzlich durch die Einnahme von psychoaktiven Substanzen induziert, spricht man hier auch von "experimenteller Mystik."

Die individuelle Ausprägung von außergewöhnlichen Bewußtseinszuständen sind maßgeblich von Set und Setting abhängig. Insbesondere fallen hier die Prädispositionen der individuellen Befindlichkeit und Konditionierung (Set) ins Gewicht. Darunter versteht man unter anderem Faktoren wie die emotionale Labilität (bzw. Stabilität), die starre Konventionalität (bzw. dynamische innovative Anpassungsfähigkeit), die optimistische Extraversion (bzw. pessimistische Introversion), die undogmatische (bzw. fundamentalistische) Religiosität, den Ästhetikbezug, etc.

Dem Ästhetikbezug wird in der Technoszene eine ganz bedeutende Rolle zugemessen. Die in dieser Szene stark ausgeprägte Ästhetisierung der Lebenswelten bezieht sich nicht nur auf das äußere Umfeld (Setting), sondern ist als "[...] Ästhetisierung auf der Ebene der Denkformen eine veränderte Wahrnehmungs- und Erkenntnispraxis. Epistemologische (erkenntnistheoretische d.A.) Ästhetisierung erteilt eine Absage an das moderne Projekt der Einheit, Wahrheit und Objektivität und strebt eine radikale Pluralisierung und Relativierung des Denkens an. [...] Ästhetisierung der Denkformen meint das Einbeziehen des Sinnhaften in den Prozeß des Erkennens, die Verbindung von Sinnlichkeit und Sinngebung. Eine derart verstandene Ästhetisierung bewirkt eine Aufhebung der Dichotomien von Körper und Geist, Sinnlichkeit und Sinn, auf denen sich die Moderne erst konstituierte."
 Die
Lust am Sinnenrausch, wie sie in der Technoszene ausgeprägt
ist, entspricht auch der Ethik dieser Gemeinschaft, sie ist nicht
moralisch, sondern ästhetisch fundiert.
Die
Lust am Sinnenrausch, wie sie in der Technoszene ausgeprägt
ist, entspricht auch der Ethik dieser Gemeinschaft, sie ist nicht
moralisch, sondern ästhetisch fundiert. 
Ein solides ästhetisches Fundament, das heißt eine stark ausgeprägte bildhafte Vorstellungskraft im Zustand des normalen Wachbewußtseins und ein hohes Potential der Empfindungsfähigkeit für das sinnlich wahrnehmbar Schöne (Ästhetische), verstärkt die Wahrscheinlichkeit einer intensiven Erlebnisfähigkeit im Bereich der visionären Umstrukturierung (VUS). Zum näheren Verständnis des Begriffes "ästhetisches Fundament" sei hier die Grundbedeutung von Ästhetik etymologisch dargelegt. Ästhetik kommt vom griechischen Verb aisqestai [aisthéstai] "fühlen, empfinden und wahrnehmen", respektive von aisqhtikoV [aisthétikós] "zum Wahrnehmen fähig". Der medizinische Fachausdruck für Betäubungsmittel Anästhetikum ist aus der Negationsform an-aisthétikós abgeleitet und bedeutet nicht fühlbar, nicht empfindbar und nicht wahrnehmbar.
Im Bereich der Drogenhilfe ist ein vertieftes Verständnis für die integralen ästhetischen Lebenswelten von großer Bedeutung, da psychoaktive Substanzen wie LSD die Erlebnisintensität im ästhetischen Bereich deutlich verstärken. So hat LSD eine starke Wesensverwandtschaft mit der Eigenschaft zur erhöhten Feinfühligkeit und Empfindsamkeit, also etwas, das ein sensibles und gut funktionierendes Nervensystem voraussetzt. LSD bewirkt somit das Gegenteil von dem, was man eigentlich von einem Betäubungsmittel (Anästhetikum) erwartet: statt Minderung oder Ausschaltung eine Intensivierung der sensorischen Feinfühligkeit.
Wie bereits aufgezeigt, ist der Fachbegriff für Betäubungsmittel, Anästhetikum, als Negation zum Begriff Ästhetik gebildet worden und bedeutet nicht empfinden, nicht wahrnehmen. Es ist widersprüchlich und sinnentstellend, Substanzen wie LSD als Betäubungsmittel zu bezeichnen, da diese Substanz das Wahrnehmungsspektrum anregt und erweitert und nicht, wie ein originäres Betäubungsmittel, das Potential für Reizempfindungen dämpft und betäubt.
Unterschiedliche Substanzen und unterschiedliche Dosierungen gleicher Substanzen bewirken deutlich unterschiedliche Veränderungen im Bereich des ästhetischen Empfindens. Diese Erkenntnis fördert das Interesse vieler Drogengebraucher für die Testergebnisse der Drug-Checking-Listen. Oft ergeben sich durch den geweckten Wissensdrang intensive und sehr persönliche Gespräche bezüglich der Wechselwirkungen zwischen bestimmten psychoaktiven Substanzen, gesellschaftlich bedingter Prägungen und dem Erleben des eigenen Bewußtseins in den Facetten unterschiedlichster ästhetischer Varianten, wobei entscheidend ist, daß nicht Notsituationen (z.B. Horrortrips) zum Zustandekommen der Gespräche führen, sondern das Interesse an Informationen und das Bedürfnis nach vertiefter Selbsterkenntnis.
Eine Vielzahl solcher Gespräche fördert nicht nur das individuelle Risikomanagement bei zahlreichen Drogengebrauchern, sondern befriedigt zugleich das Bedürfnis nach Erfahrungsaustausch mit Menschen, die selbst Einblicke in die oben beschriebenen komplexen Zusammenhänge haben. Der interaktive kommunikative Prozeß zwischen Drogenkonsumenten, der aufgrund gemeinsamer Bewußtseinszustände spezifische Fragestellungen auslöst, unterstützt die Selbstreflektion, um zum Kern der individuellen Fragestellung zu gelangen. Nicht nur der "Fragesteller" erhält hierbei eine Antwort von dem "Berater", sondern dieser erhält nicht selten durch den "Fragenden" erst die notwendigen Einsichten, um mit ihm gemeinsam das Ursprungsmotiv zu ergründen – eine Voraussetzung, um miteinander das Thema adäquat erörtern zu können (flexible Asymmetrie). Zuweilen entwickeln sich solche Zwiegespräche zu gruppendynamischen Prozessen durch Einmischung weiterer Personen und bilden die Grundlage für die Entstehung von neuen Freundschaften innerhalb der Gruppen von Partygängern und auch das Fundament für mehr soziale Stabilität in der Szene.
Neben der Unterstützung durch den eigenen Freundes- und Bekanntenkreis und der Arbeit von Szeneinitiativen können auch adäquate szenebezogene Angebote von Drogenberatungsstellen
 einen wichtigen
Bestandteil einer sozialen Partyinfrastruktur bilden. Leider
zielen aber gerade die Aktivitäten von Drogenberatungsstellen
häufig noch weit an den Bedürfnissen des Partypublikums
vorbei, weil es an der Akzeptanz alternativer Lebenswelten mangelt
und die Angebote inhaltlich und/oder in der präsentierten Form,
von den Adressaten nicht angenommen werden. Laut
einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
haben weniger als vier Prozent der aktuell Ecstasy konsumierenden
Personen die Hilfestellung einer Drogenberatungsstelle in Anspruch
genommen.
einen wichtigen
Bestandteil einer sozialen Partyinfrastruktur bilden. Leider
zielen aber gerade die Aktivitäten von Drogenberatungsstellen
häufig noch weit an den Bedürfnissen des Partypublikums
vorbei, weil es an der Akzeptanz alternativer Lebenswelten mangelt
und die Angebote inhaltlich und/oder in der präsentierten Form,
von den Adressaten nicht angenommen werden. Laut
einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
haben weniger als vier Prozent der aktuell Ecstasy konsumierenden
Personen die Hilfestellung einer Drogenberatungsstelle in Anspruch
genommen. 
Die Begriffe Set und Setting
 wurden von dem Harvard Professor für Psychologie,
Timothy Leary, in den 60er Jahren zur Beschreibung von therapeutischen
und rituellen Drogensitzungen eingeführt. Der Begriff Set
bezieht sich auf das, was das Subjekt in die Situation einbringt:
seine Erinnerungen, seine Lernfähigkeit, sein Temperament,
sein emotionales, ethisches und rationales Wertesystem, sowie, vielleicht
am wichtigsten, seine unmittelbaren Erwartungen an die Drogenerfahrung.
Das Setting bezieht sich auf das soziale, räumliche
und emotionelle Umfeld des Subjektes vor, während und nach
dem Drogengebrauch. Der wichtigste
Aspekt des Settings ist das Verhalten, das Verständnis und
das Einfühlungsvermögen der Person oder Personen,
welche die Drogen für die Gebraucher zubereiten, respektive
einteilen, und sie für den Zeitraum der Drogenwirkung begleiten
wurden von dem Harvard Professor für Psychologie,
Timothy Leary, in den 60er Jahren zur Beschreibung von therapeutischen
und rituellen Drogensitzungen eingeführt. Der Begriff Set
bezieht sich auf das, was das Subjekt in die Situation einbringt:
seine Erinnerungen, seine Lernfähigkeit, sein Temperament,
sein emotionales, ethisches und rationales Wertesystem, sowie, vielleicht
am wichtigsten, seine unmittelbaren Erwartungen an die Drogenerfahrung.
Das Setting bezieht sich auf das soziale, räumliche
und emotionelle Umfeld des Subjektes vor, während und nach
dem Drogengebrauch. Der wichtigste
Aspekt des Settings ist das Verhalten, das Verständnis und
das Einfühlungsvermögen der Person oder Personen,
welche die Drogen für die Gebraucher zubereiten, respektive
einteilen, und sie für den Zeitraum der Drogenwirkung begleiten  .
Während die rein substanzbezogenen Informationen auch aus Büchern,
Broschüren oder Flyern entnommen werden können, entziehen
sich Set und Setting einer standardisierten Betrachtungsweise.
Obwohl allgemeine Ratschläge gegeben werden können, bedarf
letztendlich jeder Einzelfall einer gesonderten Betrachtung. Die
interagierenden Faktoren der inneren Bereitschaft (Set) und der
äußeren Umstände (Setting) erschließen sich
dabei am besten aus der retrospektiven Betrachtung unterschiedlicher
Drogengebrauchssituationen und können, soweit keine geeigneten
Personen im Freundeskreis gefunden werden, mit fachkundigen Mitarbeitern
von Szeneorganisationen oder von professionellen Drogenberatungsstellen
diskutiert werden. Die reflexive Betrachtung des eigenen Drogengebrauchs
trägt zur Nutzenmaximierung bei, und ist ein wichtiger Faktor
auf dem Weg zu einem bewußten und schadensminimierten Umgang
mit psychoaktiven Substanzen.
.
Während die rein substanzbezogenen Informationen auch aus Büchern,
Broschüren oder Flyern entnommen werden können, entziehen
sich Set und Setting einer standardisierten Betrachtungsweise.
Obwohl allgemeine Ratschläge gegeben werden können, bedarf
letztendlich jeder Einzelfall einer gesonderten Betrachtung. Die
interagierenden Faktoren der inneren Bereitschaft (Set) und der
äußeren Umstände (Setting) erschließen sich
dabei am besten aus der retrospektiven Betrachtung unterschiedlicher
Drogengebrauchssituationen und können, soweit keine geeigneten
Personen im Freundeskreis gefunden werden, mit fachkundigen Mitarbeitern
von Szeneorganisationen oder von professionellen Drogenberatungsstellen
diskutiert werden. Die reflexive Betrachtung des eigenen Drogengebrauchs
trägt zur Nutzenmaximierung bei, und ist ein wichtiger Faktor
auf dem Weg zu einem bewußten und schadensminimierten Umgang
mit psychoaktiven Substanzen. - Psychotische Phänomene
-
Drug – Set – Setting
Ein Grund für den stetigen Kampf um die Interpretation der Erlebnisse nach dem Gebrauch psychoaktiver Substanzen ist die große Vielseitigkeit ihrer Wirkungen. Die spezifischen Wirkungen sind jedoch bei weitem nicht nur pharmakologisch bedingt, sondern hängen maßgeblich von den persönlichen psychologischen Vorbereitungen auf die Drogeneinnahme (Set) und von dafür geeigneten Rahmenbedingungen (Setting) ab. Wenn Drogengebraucher psychologisch gut vorbereitet sind und das Setting passend und angenehm ist, können sich in der Folge der Drogeneinnahme für die Gebraucher gänzlich neue Welten des Erlebens öffnen. Wenn jedoch das Erlebnis unter unzulänglicher Vorbereitung oder ängstlicher Erwartung leidet, wenn die Erfahrung unfreiwillig gemacht wird und das Setting nicht adäquat und/oder persönlich ist, kann eine höchst widerwärtige Reaktion nicht ausbleiben
 .
Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Manifestation einer Störung
erhöhen, sind entweder intraindividuell im Bereich des Sets
und/oder in der Umgebung der Person im Bereich des Settings identifizierbar.
.
Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Manifestation einer Störung
erhöhen, sind entweder intraindividuell im Bereich des Sets
und/oder in der Umgebung der Person im Bereich des Settings identifizierbar.Die öffentlich geschürte Angst vor psychoaktiven Substanzen sitzt tief verankert im Bewußtsein vieler potentieller und auch praktizierender Drogengebraucher und ist somit oftmals ein nicht unbedeutender negativer Faktor im persönlichen Set. Diese Angst steht diametral dem unabdingbaren Wunsch gegenüber, mittels psychoaktiver Substanzen transzendentale Bewußtseinserfahrungen zu erleben. Es sind also nicht so sehr medizinische Gründe, die die Angst vor diesen Substanzen verursachen, sondern vielmehr die von der Gesellschaft auf das Individuum übertragene Angst, daß mittels dieser Substanzen bei der Durchbrechung des Seelenpanzers Inhalte zum Vorschein kommen könnten, die unbekannt, respektive unvertraut sind und die das Bewährte und Selbstverständliche im eigenen Selbst in Frage stellen könnten
 . Der Ursprung dieses Angstszenarios
liegt in der Tatsache begründet, daß mit dem Gebrauch
von Rauschmitteln Bewußtseinszustände so verändert
werden können, daß durch Variationen des bewußten
Erlebens neue Einblicke in
nicht alltägliche Wirklichkeiten und damit in andere Dimensionen
von Erfahrungen eröffnet werden
. Der Ursprung dieses Angstszenarios
liegt in der Tatsache begründet, daß mit dem Gebrauch
von Rauschmitteln Bewußtseinszustände so verändert
werden können, daß durch Variationen des bewußten
Erlebens neue Einblicke in
nicht alltägliche Wirklichkeiten und damit in andere Dimensionen
von Erfahrungen eröffnet werden  . Die Suche nach diesen
Risikofaktoren im oben bezeichneten Bereich und die Versuche ihrer
Vermeidung gehören zur Basisarbeit jeder konstruktiven Drogenberatung.
Hierbei spielt die Reflexion persönlicher Drogenerfahrungen
eine zentrale Rolle.
. Die Suche nach diesen
Risikofaktoren im oben bezeichneten Bereich und die Versuche ihrer
Vermeidung gehören zur Basisarbeit jeder konstruktiven Drogenberatung.
Hierbei spielt die Reflexion persönlicher Drogenerfahrungen
eine zentrale Rolle.Erfahrungen aus der Technokultur belegen, daß Technoparties ein äußerst beliebtes und oft genutztes Setting für die Einnahme psychoaktiver Substanzen sind. Dies liegt einerseits an der intensiven Gruppendynamik, die sich auf einem Dancefloor entwickelt und in der man sich geradezu laben kann, anderseits am Gefühl der Geborgenheit, das durch das gemeinsames Erleben ekstatischer Zustände vermittelt wird. Dieses Geborgenheitsgefühl wird durch die empatische Wirkung von Ecstasy zusätzlich gesteigert. Störungen in dem subtilen Gefüge des Partysettings können nachhaltige negative Auswirkungen auf einzelne an der Party teilnehmenden Personen verursachen, wobei es hierbei völlig belanglos ist, ob die Personen im Augenblick der Störung nüchtern oder unter Einwirkung bestimmter Drogen sind. Dies liegt in der Tatsache begründet, daß Menschen, die sich über Stunden hinweg in Trance und Ekstase (hinein)tanzen, äußerst sensibel und verletzlich sind. Das heißt, daß präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Störungen im Kontext von Technoparties, nicht nur im Wohlergehen von Drogengebrauchern begründet sind, sondern zum Wohl aller getroffen werden müssen. Somit erfordert jede Beratung im Kontext von Technoparties, wenn sie erfolgreich sein soll, nicht nur ein differenziertes Erfahrungspotential bezüglich Drogenwirkungen, sondern auch ein hohes Maß an Kenntnissen bezüglich ekstatischer Zustände und ein gut geschultes Einfühlungsvermögen bezüglich Trancezuständen.
Erfahrungen aus der Technokultur belegen, daß Technoparties ein äußerst beliebtes und oft genutztes Setting für die Einnahme psychoaktiver Substanzen sind. Dies liegt einerseits an der intensiven Gruppendynamik, die sich auf einem Dancefloor entwickelt und in der man sich geradezu laben kann, anderseits am Gefühl der Geborgenheit, das durch das gemeinsames Erleben ekstatischer Zustände vermittelt wird. Dieses Geborgenheitsgefühl wird durch die empatische Wirkung von Ecstasy zusätzlich gesteigert. Störungen in dem subtilen Gefüge des Partysettings können nachhaltige negative Auswirkungen auf einzelne an der Party teilnehmenden Personen verursachen, wobei es hierbei völlig belanglos ist, ob die Personen im Augenblick der Störung nüchtern oder unter Einwirkung bestimmter Drogen sind. Dies liegt in der Tatsache begründet, daß Menschen, die sich über Stunden hinweg in Trance und Ekstase (hinein)tanzen, äußerst sensibel und verletzlich sind. Das heißt, daß präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Störungen im Kontext von Technoparties, nicht nur im Wohlergehen von Drogengebrauchern begründet sind, sondern zum Wohl aller getroffen werden müssen. Somit erfordert jede Beratung im Kontext von Technoparties, wenn sie erfolgreich sein soll, nicht nur ein differenziertes Erfahrungspotential bezüglich Drogenwirkungen, sondern auch ein hohes Maß an Kenntnissen bezüglich ekstatischer Zustände und ein gut geschultes Einfühlungsvermögen bezüglich Trancezuständen.
-
Risiken und Gefahrenpotential
Unter Berücksichtigung der hohen Zahl von Partydrogenkonsumenten und der in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen aufgezeigten physischen und psychischen Probleme, die mit dem Konsum von Partydrogen einhergehen können, ist die Zahl registrierter Notfälle in medizinischen Hilfeeinrichtungen wesentlich geringer, als vielfach vermutet wird. Nach einer britischen Studie beträgt die Wahrscheinlichkeit, den Besuch eines Raves in der Notfallaufnahme eines Krankenhauses zu beenden, 230 zu einer Million. Die große Mehrzahl der (meistens wegen Herzrasens) eingelieferten und untersuchten Personen konnte dabei nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen
 . Russell Newcombe gibt an, daß von 17.000 Besuchern
eines Clubs, in dem Ecstasy in großem Umfang genommen wurde,
vier mit Hitzschlag in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, von
dem sich alle wieder erholten. Auch hier kommt man auf ein ähnliches
Verhältnis: 235 zu einer Million.
. Russell Newcombe gibt an, daß von 17.000 Besuchern
eines Clubs, in dem Ecstasy in großem Umfang genommen wurde,
vier mit Hitzschlag in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, von
dem sich alle wieder erholten. Auch hier kommt man auf ein ähnliches
Verhältnis: 235 zu einer Million."Das Risiko, an Ecstasy zu sterben, ausgedrückt durch das Verhältnis der Zahl der Todesfälle zu jener der Ecstasy-Konsumenten, sei sehr klein. Es reiche von minimal einem Todesfall auf 17 Millionen Konsumenten bis maximal einem auf eine Million. Beim Reiten betrügen die entsprechenden Zahlen 1 zu 3,3 Millionen, beim Fischen 1 zu 4,5 Millionen. Das Skifahren sei mindestens 2-mal und das Fallschirmspringen 10- bis 170-mal so riskant wie der Ecstasy-Konsum."!

Die vielleicht etwas populistisch anmutenden Zahlen resultieren aus der Analyse internationaler wissenschaftlicher Literatur. In einem Kommissionsbericht zur Bewertung des Gefahrenpotentials von Drogen unter Leitung von Professor Bernard Roques (Abteilungsdirektor des Nationalen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung) an den Französischen Staatssekretär für Gesundheit wird das Gefahrenpotential von Ecstasy (MDMA) und Psychostimulantien (wie z.B. Amphetamin) höher eingeschätzt als das von Cannabis, aber geringer als jenes von Alkohol und Kokain
 . Auf der folgenden
Seite ist eine Zusammenstellung der Gefahrenpotentiale von Drogen
(gemäß der Roques-Studie) abgedruckt.
. Auf der folgenden
Seite ist eine Zusammenstellung der Gefahrenpotentiale von Drogen
(gemäß der Roques-Studie) abgedruckt.Der Kassationshof des Schweizerischen Bundesgerichtes in Lausanne kommt in einem Urteil in Sachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz am 21. April 1999 zu folgender Bewertung betreffend Risiken und Gefahrenpotential von Ecstasy: "Ecstasy mache nicht im eigentlichen Sinne süchtig. Ein chronischer Mißbrauch der Droge und Entzugserscheinungen (wie bei Opiaten) seien nicht bekannt. Es sei offenbar ohne Probleme und Folgen möglich, den Ecstasykonsum einzustellen. Die Droge werde von gesellschaftlich integrierten jungen Leute konsumiert. Anders als bei Heroin und Kokain seien keine Verelendungsmechanismen zu beobachten, und es sei keine Folge- oder Beschaffungskriminalität bekannt. Auch diese äußeren Erscheinungsformen des Konsums deuten darauf hin, daß Ecstasy in die Kategorie der weichen Drogen einzuordnen und jedenfalls nicht mit den harten Drogen wie Heroin oder Kokain gleichzusetzen sei."

Tabelle I
Roques-Report: Probleme durch das Gefahrenpotential von Drogensehr hohes Gefahrenpotential
mittleres Gefahrenpotential
geringes G.
Opioide1
Alkohol
Kokain
Ecstasy
Speed2
Benzos3
Tabak
Cannabis
Körperliche
Abhängigkeitsehr
starksehr
starkschwach
sehr
schwachschwach
mittel
stark
schwach
Psychische
Abhängigkeitsehr
starksehr
starkstark
(variabel)?
mittel
stark
sehr
starkschwach
Nerven-
giftigkeitschwach
stark
stark
sehr
stark (?)stark
0
0
0
Allgemeine
Giftigkeitstark4
stark
stark
evtl. sehr
starkstark
sehr
schwachsehr stark
(Krebs)sehr
schwachSoziale
Gefährlichkeitsehr
starkstark
sehr
starkschwach
schwach
(Ausn. Mögl.)schwach5
0
schwach
Behandlungs-Möglichkeiten
(u.a. Substitution)ja
ja
ja
nein
nein
nicht
erforschtja
nicht
erforscht1 z.B. Heroin
2 Psychostimulantien
3 Benzodiazepine (Beruhigungsmittel) wie z.B. Valium;
4 Methadon und Morphin als Therapeutika ungiftig
5 außer Autofahren und bestimmte psychische Konstellationen
Und weiter heißt es in dem Urteil: "Schwerwiegende psychische und physische Schäden auf Grund des Gebrauchs von Ecstasy sind – dies bei weltweit massenhaftem Konsum – selten. Nach dem heutigen Wissenstand kann nicht gesagt werden, daß Ecstasy geeignet sei, die körperliche und seelische Gesundheit in eine naheliegende und ernstliche Gefahr zu bringen.
 " Die
Bewertung stützt sich auf Gutachten von sechs renommierten
Schweizer Forschungseinrichtungen
" Die
Bewertung stützt sich auf Gutachten von sechs renommierten
Schweizer Forschungseinrichtungen  .
.Auch in Deutschland bewerten die Gerichte Ecstasy als sogenannte weiche Droge. Den Ausgangspunkt für die rechtliche Bewertung bildet ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 9. Oktober 1996
 zum Begriff der
"nicht geringen Menge" bei MDE. Das
Gericht kommt nach Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zu
folgendem Schluß: "Anzeichen physischer Abhängigkeit
haben sich bisher nicht feststellen lassen; jedoch kann MDMA zu
hoher, MDE zu mittlerer psychischer Abhängigkeit führen.
Anders als bei Amphetamin führt der Konsum in aller Regel nicht
zu Dosissteigerungen.
zum Begriff der
"nicht geringen Menge" bei MDE. Das
Gericht kommt nach Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zu
folgendem Schluß: "Anzeichen physischer Abhängigkeit
haben sich bisher nicht feststellen lassen; jedoch kann MDMA zu
hoher, MDE zu mittlerer psychischer Abhängigkeit führen.
Anders als bei Amphetamin führt der Konsum in aller Regel nicht
zu Dosissteigerungen.  " Zu
den gesundheitlichen Auswirkungen führt das Gericht weiter
aus: "Dabei sind es häufig nicht so sehr die primären
Giftwirkungen als vielmehr szenetypische Begleitumstände des
Konsums, welche die Gefährlichkeit der Amphetaminderivate als
Inhaltsstoffe von Ecstasy-Tabletten begründen.
" Zu
den gesundheitlichen Auswirkungen führt das Gericht weiter
aus: "Dabei sind es häufig nicht so sehr die primären
Giftwirkungen als vielmehr szenetypische Begleitumstände des
Konsums, welche die Gefährlichkeit der Amphetaminderivate als
Inhaltsstoffe von Ecstasy-Tabletten begründen.  " Daraus
leitet der BGH ab, daß "in der Beurteilung der Drogengefährlichkeit
[...] der Senat eine Gleichbehandlung von MDMA, MDE und MDA für
sachlich gerechtfertigt [hält]. Auch wenn sie unter Gefährlichkeitsaspekten
dem Amphetamin nicht gleichzustellen sind, müssen
sie bei wertender Betrachtung doch immerhin als annähernd so
gefährlich wie Amphetamin eingestuft werden."
" Daraus
leitet der BGH ab, daß "in der Beurteilung der Drogengefährlichkeit
[...] der Senat eine Gleichbehandlung von MDMA, MDE und MDA für
sachlich gerechtfertigt [hält]. Auch wenn sie unter Gefährlichkeitsaspekten
dem Amphetamin nicht gleichzustellen sind, müssen
sie bei wertender Betrachtung doch immerhin als annähernd so
gefährlich wie Amphetamin eingestuft werden." 
Sehr anschaulich kann das Gefährdungspotential verschiedener Drogen anhand der Anzahl von notwendigen Erste-Hilfe-Einsätzen und Krankenhauseinweisungen anläßlich der beiden größten Techno-Paraden in Europa dargelegt werden. An beiden Paraden konsumieren eine erhebliche Zahl der Teilnehmer die unterschiedlichsten Partydrogen: Haschisch, Ecstasy, Amphetamin, LSD, Zauberpilze, etc. Es gibt nur einen gewichtigen Unterschied: Alkohol wird an der Street Parade kaum konsumiert, da entlang der Route kein Alkohol ausgeschenkt wird.
Eine vergleichende Analyse der beiden größten Techno Paraden, der Love Parade in Berlin und der Street Parade in Zürich aus den Jahren 1998 und 1999 zeigt deutlich die Größe des Risikofaktors Alkohol im Vergleich zu allen anderen gängigen Partydrogen. Diesbezüglich lassen die Zahlen der Erste-Hilfe-Leistungen wie auch die Zahlen der Krankenhauseinweisungen an den Techno-Paraden in Berlin und in Zürich klare Rückschlüsse auf die Präventionskonzepte und die Sicherheit in den beiden Städten zu. In Zürich ist die Zahl der verletzten Personen an den jeweiligen Anlässen deutlich geringer als in Berlin. Das Zürcher Präventionskonzept bezüglich Sicherheit ist dem Berliner "Modell" klar überlegen. Die folgenden Tabellen zeigen die zahlenmäßigen Unterschiede auf.

Tabelle II
Krankenhauseinweisungen und Erste-Hilfe-Leistungen an der Love Parade und Street Parade 1998Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Anzahl der Krankenhaus- Einweisungen
Anzahl pro 100.000 Personen
Rel. L. zu St. P.
Anzahl der Erste Hilfe- Einsätze
Anzahl pro 100.000 Personen
Rel. L. zu St. P.
Love Parade 1998
gemäß Polizeiangaben
400.000
340
85
17
2.530
633
11
gemäß Malteser-Dienst
750.000
340
45
9
2.530
337
6
gemäß Veranstalter
1.100.000
340
31
6
2.530
230
4
Street Parade 1998
Auswertung Luftaufnahmen
500.000
25
5
295
59
Die Anzahl der TeilnehmerInnen an den jeweiligen Tanzparaden ist mit Quellenangabe der Zählung, respektive der Schätzung, in der linken Spalte angegeben. Danach folgt die absolute Zahl der Krankenhauseinweisungen an den jeweiligen Paraden in Spalte zwei, danach folgt die entsprechende Zahl bezogen auf 100.000 Personen in Spalte drei.
"Rel. L. zu St." bedeutet die Relation der Häufigkeit der Krankenhauseinweisungen von der Love Parade in Berlin zur Street Parade in Zürich. Gemäß Spalte vier war die Häufigkeit in Berlin mindestens sechs-, höchstens 17mal größer als in Zürich. In der drittletzten Spalte ist die absolute Zahl der Erste-Hilfe-Einsätze angegeben, in der zweitletzten Spalte die entsprechende relative Zahl bezogen auf 100.000 Teilnehmer und in der letzten Spalte wiederum die Relation der Zahlen von Berlin und Zürich. So mußten gemäß Polizeiangaben in Berlin mehr als das Zehnfache an Personen medizinisch betreut und weit mehr als das Zehnfache an Personen in Krankenhäusern eingeliefert werden als in Zürich, gemäß Veranstalterangaben war es immer noch etwa das Vierfache, respektive Sechsfache.
Die Wahrscheinlichkeit, sich in Berlin an der Love Parade zu verletzen oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen anheimzufallen, war 1998 wie auch 1999 nachweislich um ein Vielfaches größer als an der Street Parade in Zürich. Die Tabelle mit den Vergleichsdaten für 1999 ist auf der nächsten Seite abgedruckt. Der ausschlaggebende Risikofaktor heißt Alkohol. Entlang der Route der Street Parade in Zürich werden keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. Vielmehr sind die Wirte auf freiwilliger Basis angehalten, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Parade, alkoholische Getränke nur innerhalb der Ladenlokale auszuschenken und auf den Verkauf von Alkohol in Straßencafés und Biergärten gänzlich zu verzichten. Hingegen werden in Berlin vorwiegend alkoholische Getränke entlang der Route angeboten, zudem ist das Sortiment alkoholfreier Getränke, verglichen mit Zürich, äußerst mager.
Tabelle III
Krankenhauseinweisungen und Erste-Hilfe-Leistungen an der Love Parade und Street Parade 1999Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Anzahl der Krankenhaus- Einweisungen
Anzahl pro 100.000 Personen
Rel. L. zu St. P.
Anzahl der Erste Hilfe- Einsätze
Anzahl pro 100.000 Personen
Rel. L. zu St. P.
Love Parade 1999
gemäß Malteser-Dienst
1.400.000
337
24
6
4.521
323
8
gemäß Veranstalter
1.500.000
337
22
5
4.521
301
7
Street Parade 1999
Auswertung Luftaufnahmen
550.000
24
4
230
42
Die Tabelle für 1999 ist genauso aufgebaut die wie Tabelle II für das Jahr 1998. Die Häufigkeit (Anzahl pro 100.000 Personen) der Krankenhauseinweisungen war an der Love Parade in Berlin 1999 fünf- bis sechsmal größer als an der Street Parade in Zürich. Die Häufigkeit der Erste-Hilfe-Einsätze war an der Love Parade in Berlin 1999sogar sieben- bis achtmal größer als an der Street Parade in Zürich.
-
Faktoren des Risiko- und Gefahrenpotentials
Wirkungen und gesundheitliche Risiken beim Partydrogengebrauch hängen nicht nur von der Art der konsumierten Substanz, sondern auch von weiteren Faktoren ab: der Dosierung und Qualität (Reinheit) der präferierten Substanz, dem psychischen und physischen Zustand des Konsumenten und der vorgefundenen oder gewählten Konsumumgebung.
 Diese Parameter werden am Beispiel Ecstasy in den folgenden Ausführungen
erläutert, lediglich bei der Dosisabhängigkeit und der
Möglichkeit einer Toleranzentwicklung (Gewöhnung, das
heißt gleiche Drogenwirkung erst durch höhere Dosierung)
wird auf das ganze Spektrum der gängigen Partydrogen und Opiate
eingegangen. Die Bedeutung der Verunreinigungsproblematik wird evident
bei der Betrachtung der Berliner Lidocain-Tetracain-Kokain Studie.
Es geht in dieser Ausführung nicht darum, ein differenziertes
pharmakologisches Profil einzelner Substanzen zu zeichnen (dazu
sei auf die zitierte Literatur verwiesen), sondern an ausgewählten
Beispielen die Prinzipien und Mechanismen aufzuzeigen, welche für
die Bewertung und gesundheitsförderliche Umsetzung von Drug-Checking-Ergebnissen
von Bedeutung sind.
Diese Parameter werden am Beispiel Ecstasy in den folgenden Ausführungen
erläutert, lediglich bei der Dosisabhängigkeit und der
Möglichkeit einer Toleranzentwicklung (Gewöhnung, das
heißt gleiche Drogenwirkung erst durch höhere Dosierung)
wird auf das ganze Spektrum der gängigen Partydrogen und Opiate
eingegangen. Die Bedeutung der Verunreinigungsproblematik wird evident
bei der Betrachtung der Berliner Lidocain-Tetracain-Kokain Studie.
Es geht in dieser Ausführung nicht darum, ein differenziertes
pharmakologisches Profil einzelner Substanzen zu zeichnen (dazu
sei auf die zitierte Literatur verwiesen), sondern an ausgewählten
Beispielen die Prinzipien und Mechanismen aufzuzeigen, welche für
die Bewertung und gesundheitsförderliche Umsetzung von Drug-Checking-Ergebnissen
von Bedeutung sind.-
Dosisabhängigkeit

Die Wirkungen und Nebenwirkungen der Wirkstoffe der Ecstasygruppe (MDMA, MDE, MBDB, MDA) sind wie die von Amphetamin, Methamphetamin, Kokain, LSD und Psilocybin/Psilocin überwiegend dosisabhängig. Besonders ausgeprägt ist die Dosisabhängigkeit bei MDA: Während niedrige Dosen hauptsächlich antriebssteigernd wirken, führen höhere Dosen zu (Pseudo-)Halluzinationen.
Auch die im Zusammenhang mit Ecstasy kontrovers diskutierte "Neurotoxizität" soll in ihrem Ausmaß dosisabhängig sein. Sie steigert sich, dem heutigen Stand der Kenntnis entsprechend, höchst wahrscheinlich von der Substanz MDE über MDMA zum Amphetaminderivat MDA hin. Inwieweit diese durch Tierexperimente gewonnenen Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind, ist bislang nicht geklärt. Dennoch können mögliche neurofunktionale Langzeiteffekte durch dauerhaften Ecstasykonsum nicht ausgeschlossen werden, obgleich funktionelle Veränderungen wie Verhaltensauffälligkeiten, Beeinträchtigung von Gedächtnisfunktionen, Aufmerksamkeit und Problemlöseverhalten noch nicht nachgewiesen werden konnten. Entgleisungen psychotroper Akuteffekte (Panikatacken, atypische und paranoide Psychosen) treten meist im Zusammenhang mit Überdosierung und/oder Drogenbeikonsum auf. Bei anderen Nebenwirkungen, beispielsweise der Hyperthermie, lassen sich nur schwer direkte Dosis-Wirkungs-Zusammenhänge nachweisen.
Besonders dramatisch wirken sich die Konzentrationsschwankungen im Drogenverschnitt bei Opiat- (Heroin) gebrauch aus: Liegt die reine Opiatkonzentration deutlich höher als auf dem Schwarzmarkt üblich, kann es schnell zu einer tödlichen Überdosierung kommen. Atemdepression und Atemstillstand sind dann die Todesursache.
 Nach den Erfahrungen
des Eve & Rave Drug-Checking-Programms unterliegen die Wirkstoffkonzentrationen
aller illegalisierten Partydrogen erheblichen Schwankungen.
Nach den Erfahrungen
des Eve & Rave Drug-Checking-Programms unterliegen die Wirkstoffkonzentrationen
aller illegalisierten Partydrogen erheblichen Schwankungen. 
-
Konsumfrequenz und Toleranzentwicklung
In Folge der durch Ecstasy verursachten akuten Freisetzung von Serotonin, kommt es zu einer länger anhaltenden Verringerung dieses Transmitters im Gehirn, da gleichzeitig die Aktivität der Tryptophanhydrolase (Tryptophan ist ein chemischer Grundbaustein von Serotonin) gehemmt wird. Dies ist der Grund für den Wirkungsabfall (Toleranzentwicklung) bei wiederholter Einnahme. Durch das Einhalten von ein- bis vierwöchigen Einnahmeabständen wird das Toleranzphänomen umgangen. Der Serotoninmetabolitenspiegel im Gehirn ist nach 24 Stunden normalisiert.

Eine starke (und schnelle) Toleranzentwicklung tritt bei Amphetamin, Methamphetamin, LSD und Psilocybin / Psilocin ein, während bei Kokain das Ausmaß der Toleranzentwicklung als begrenzt gilt. Es läßt sich hier höchstens eine Verdopplung der Dosis, um die gleiche Wirkung zu erreichen, beobachten. Die entstandene Toleranz bildet sich relativ schnell zurück. Die Toleranz gegenüber Opiaten (zum Beispiel Heroin) schwankt je nach physiologischer Reaktion des Konsumenten auf die Dosis und die Häufigkeit der Verabreichung. Eine Toleranz entwickelt sich bei Dauerkonsumenten von Opiaten gegenüber der atemdepressiven, analgetischen, euphorisierenden und sedierenden Wirkung des Stoffes. Die wiederholte Verabreichung erzeugt eine derart ausgeprägte Toleranz, daß massive Dosissteigerungen (um den Faktor 10 bis 30) zur Erzielung der Euphorie oder zur Verhinderung der Entzugsbeschwerden nötig sind. Die letale Dosis liegt bei Personen ohne Toleranz bei Opiaten bei 50 mg bis 75 mg, bei Personen mit Toleranz bei bis zu 1500 mg (1,5 g). Ein besonders hohes Risiko besteht beim Opiatgebrauch nach einer abgebrochenen Therapie, wenn ohne Berücksichtigung des Status der Toleranz dosiert wird, da unter anderem die Toleranz gegen Atemdepressionen durch die Abstinenzphase aufgehoben, respektive stark reduziert wurde. Dies zeigt sich an der Tatsache, daß knapp ein Drittel der Drogenabhängigen, die in Deutschland an den Folgen des Drogenkonsums gestorben sind, kurz vor dem Tod gerade aus der Therapie oder der Haft entlassen worden sind.

-
Verunreinigungen
Die gesundheitlichen Risiken des Amphetaminkonsums gehen primär auf die Toxizität der Substanzen selbst und nicht auf toxische Syntheseverunreinigungen oder Verschnittstoffe zurück. Bei den sehr selten auftretenden Leberschädigungen in Zusammenhang mit Ecstasykonsum wird jedoch eine Verunreinigung oder ein MDMA-Metabolit als Auslöser in Betracht gezogen. Neben nicht determinierten Syntheseverunreinigungen können Ecstasytabletten und andere Partydrogen durch Arzneistoffe wie zum Beispiel Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Coffein, Chinin oder Salicylsäure "verschmutzt" sein. Der Konsum solcher Stoffe kann bei Personen mit entsprechenden Überempfindlichkeiten und Vorschädigungen (z.B. Magen, Leber, Niere) zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. Besonders problematisch kann sich die Einnahme von Zubereitungen auswirken, wenn sich hoch wirksame Stoffe wie zum Beispiel Amphetamin, Methamphetamin oder Atropin, die sehr lange psychoaktiv wirken, unerwartet in den dargereichten Pillen oder Pulvern befinden. In Perioden, in denen solche Stoffe auf dem Betäubungsmittelmarkt vermehrt kursierten, stand das Telephon bei vielen Mitarbeitern von Szeneorganisationen nicht mehr still, weil viele verunsicherte Konsumenten, die mit unter mehrere Tage mit der nicht mehr gewollten und auch nicht mehr zu verkraftenden Drogenwirkung konfrontiert waren, Rat und Hilfe suchten.
Besonderes die Verunreinigung von Kokain mit Lidocain stellt ein Leben bedrohendes Problem dar, wie eine Studie dreier rechtsmedizinischer Institute in Berlin zur toxikologischen Bewertung der Lokalanästhetika Lidocain und Tetracain bei Drogentodesfällen feststellt
 . Häufig
werden dem Kokain jene
in Apotheken freiverkäuflichen und im Vergleich zu Kokain
sehr billigen Lokalanästhetika Lidocain und Tetracain zugesetzt
. Häufig
werden dem Kokain jene
in Apotheken freiverkäuflichen und im Vergleich zu Kokain
sehr billigen Lokalanästhetika Lidocain und Tetracain zugesetzt  .
Hierdurch erhöht sich die Gewinnspanne der am Handel beteiligten
Akteure. Sowohl das Landeskriminalamt Berlin als auch das Bundesministerium
für Gesundheit warnen
daher die Apotheker eindringlich vor einer unkritischen Abgabe
von Lidocain
.
Hierdurch erhöht sich die Gewinnspanne der am Handel beteiligten
Akteure. Sowohl das Landeskriminalamt Berlin als auch das Bundesministerium
für Gesundheit warnen
daher die Apotheker eindringlich vor einer unkritischen Abgabe
von Lidocain  . Einer der Hauptgründe für den Lidocainverschnitt
liegt in der lokalanästhetischen Wirkung dieses Stoffes,
durch den beispielsweise beim Zungentest Kokain leicht vorgetäuscht
werden kann. Besonders problematisch ist Lidocain- oder Tetracainverschnitt,
wenn Kokain weder geschnupft noch geraucht, sondern intravenös
injiziert wird. In Berlin waren gehäuft Todesfälle
zu verzeichnen, bei denen sehr hohe Blutkonzentrationen von
Lidocain oder Tetracain-Metaboliten ursächlich, beziehungsweise
maßgeblich als Todesursache festgestellt wurden. Letztendlich
führte die Lähmung des zentralen Nervensystems oder
die Blockade des Herz-Reizleitungs-Systems zum Tode. Seit
1995 waren insgesamt 46 Fälle im Zusammenhang mit Lidocain
und 13 weitere Todesfälle durch Tetracain zu beklagen
. Einer der Hauptgründe für den Lidocainverschnitt
liegt in der lokalanästhetischen Wirkung dieses Stoffes,
durch den beispielsweise beim Zungentest Kokain leicht vorgetäuscht
werden kann. Besonders problematisch ist Lidocain- oder Tetracainverschnitt,
wenn Kokain weder geschnupft noch geraucht, sondern intravenös
injiziert wird. In Berlin waren gehäuft Todesfälle
zu verzeichnen, bei denen sehr hohe Blutkonzentrationen von
Lidocain oder Tetracain-Metaboliten ursächlich, beziehungsweise
maßgeblich als Todesursache festgestellt wurden. Letztendlich
führte die Lähmung des zentralen Nervensystems oder
die Blockade des Herz-Reizleitungs-Systems zum Tode. Seit
1995 waren insgesamt 46 Fälle im Zusammenhang mit Lidocain
und 13 weitere Todesfälle durch Tetracain zu beklagen  .
Abschließend resümieren
die Autoren der Studie: "Die von uns vorgestellten
Beispiele stehen im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung,
daß die pharmakodynamischen Wirkungen von Beimischungen
bei Drogenapplikation allgemein von untergeordneter toxikologischer
Bedeutung sind."
.
Abschließend resümieren
die Autoren der Studie: "Die von uns vorgestellten
Beispiele stehen im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung,
daß die pharmakodynamischen Wirkungen von Beimischungen
bei Drogenapplikation allgemein von untergeordneter toxikologischer
Bedeutung sind." 
Auch auf Grund dieser Erkenntnisse ist es unverständlich, daß die Bundesopiumstelle in Kenntnis der Sachlage dem Rechtsmedizinischen Institut der Charité die Erlaubnis entzog, betäubungsmittelverdächtige Substanzen von Szeneorganisationen oder Privatpersonen zwecks Analyse entgegenzunehmen. Wäre das Drug-Checking-Programm in Zusammenarbeit mit dem Verein Eve & Rave und dem oben genannten Institut weiterhin durchgeführt und des weiteren auf den Kreis der intravenös Kokain Konsumierenden ausgeweitet worden, hätte zum einen die vornehmlich umsatzorientierte und äußerst leichtfertige Abgabe von Lidocain seitens der Apothekerschaft an mutmaßliche Drogenkonsumenten frühzeitig erkannt werden können, zum anderen hätte man sicherlich die Gesellschaftskreise, in denen die Verstorbenen verkehrten, rechtzeitig über das Gefahrenpotential jener Substanzen informieren können. Durch ein sinnvoll angelegtes Drug-Checking von Kokainproben hätten die Abgabefehler der Apothekerschaft abgefedert und Leben gerettet werden können. Dieser Vorgang verdeutlicht, wie Entscheidungen, die der Logik des abstrakten Abstinenzparadigma gehorchen, die Letalität beim Drogengebrauch erhöhen können.
Das Lidocain-Tetracain-Kokain Beispiel zeigt die Notwendigkeit der lebensweltnahen Organisation von Drug-Checking-Programmen auf. Der Verein hat relativ selten Kokainproben zur Untersuchung eingereicht, da Eve & Rave als Party-Szene-Organisation die Drogengebraucher aus der Szene der Fixer kaum erreicht. Um in dieser Gruppe der Drogengebraucher die gesundheitliche Sicherheit zu erhöhen, ist Drug-Checking in Druckräumen (Konsumräumen, Fixerstuben) oder Kontaktcafés als Maßnahme der Überlebenshilfe durchzuführen.
-
Vorschädigungen
Eine bestehende funktionelle Herz-Kreislauf-Störung oder eine akute Atemwegerkrankung erhöht das Risiko eines letalen Kreislaufkollapses nach Ecstasykonsum. Gefährliche im Bereich des Zentralnervensystems auftretende Störungen sind zumeist auf eine bereits bestehende individuelle Vulnerabilität zurückzuführen, das heißt, daß Menschen, die durch genetisch, organisch, aber auch psychologisch und sozial bedingte individuelle Disposition auf Belastungen überdurchschnittlich stark mit Spannung, Angst, Verwirrung bis hin zu psychotischer Dekompensation reagieren, besonders gefährdet sind. Ecstasykonsum kann bei vermutlich individueller Disposition protrahierte psychiatrische Störungen hervorrufen.
Den Ecstasywirkstoffen kommt demnach bei der Entstehung psychiatrischer Komplikationen lediglich eine Auslöserfunktion (Triggerfunktion) zu.

Nur ein Arzt kann eine unentdeckte gesundheitliche Vorschädigung sicher feststellen. Eine Zusammenarbeit der am Drug-Checking beteiligten Organisationen mit in der Partydrogenthematik vertrauten Ärzten wäre eine sinnvolle Ergänzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Drug-Checking-Programms. In diesem Zusammenhang erfahrene und vertrauenswürdige Ärzte sollten nicht nur mit den vor Ort tätigen Organisationen Hand in Hand zusammenarbeiten, sondern auch mit der zentralen Bundeskoordinierungsstelle, zwecks Erfahrungsaustausch und Weiterbildung, Kontakt pflegen. Anzustreben wäre die Empfehlung eines Gesundheitscheck analog einer sportärztlichen Untersuchung (z.B. Belastungs-EKG, -EEG, Lungenfunktionstest, Bestimmung der "Leberwerte" und Überprüfung der Nierenfunktion) an alle konsumentschlossenen Personen.
________________________
Nickels will Warnsystem für Drogensüchtige
"AFP Hamburg/Berlin – Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Christa Nickels (Grüne), hat angesichts der steigenden Zahl von Rauschgifttoten ein flächendeckendes Frühwarnsystem zur Drogenreinheit verlangt. Sie sagte der Welt am Sonntag, Drogenabhängige müßten rechtzeitig vor Stoff mit hohem Reinheitsgrad, der besonders stark sei, gewarnt werden.
Zur Rettung des Lebens von Drogenabhängigen sollten außerdem Rettungsdienste und Polizei entkoppelt werden. Viele (Opiat-) Abhängige hätten Angst, daß bei einer Alarmierung des ärztlichen Notdienstes automatisch die Polizei informiert werde. »Diese Angst müssen wir ihnen nehmen«, sagte Nickels.
Nach Nickels Worten erwägt die Bundesregierung zudem die Abgabe von Notfallmedikamenten an Drogensüchtige. Das Bundesforschungsministerium habe in Berlin einen Modellversuch gefördert, mit dem geprüft werde, ob Medikamente künftig vorbeugend an Drogenabhängige ausgegeben werden könnten. Pragmatische Lösungen müßten Vorrang vor dem Risiko weiterer Todesfällen haben. Als neue Problemgruppe erwiesen sich derzeit junge Aus- und Übersiedler. Sie stiegen sehr schnell auf harte Drogen um. Berlins Innensenator Eckart Werthebach (CDU) wandte sich gegen Liberalisierungen in der Drogenpolitik. Dem Sender Hundert,6 sagte er, die Zahl der Rauschgiftdelikte in Berlin sei im ersten Quartal um 99 Prozent höher gewesen als im Vorjahr."
Berliner Morgenpost online 21.05.2000
-
Fussnoten:
H. Cousto: Drogeninduzierte und andere außergewöhnliche Bewußtseinszustände. Ein Bericht über Sucht und Sehnsucht, Transzendenz, Ich-Erfahrungen und außergewöhnliche Bewußtseinszustände, Solothurn 1998, S.8.

A. Huxley: Die Pforten der Wahrnehmung. Himmel und Hölle, München 1970.

A. Dittrich, D. Lamparter: Differenzielle Psychologie außergewöhnlicher Bewußtseinszustände – Ergebnisse experimenteller Untersuchungen mit sensorischer Deprivation, (...), a.a.O., S.62.

A. Dittrich, D. Lamparter: Differenzielle Psychologie außergewöhnlicher Bewußtseinszustände – Ergebnisse experimenteller Untersuchungen mit sensorischer Deprivation, (...), a.a.O., S. 60; Vgl.: I. Bodmer, A. Dittrich, D. Lamparter: Außergewöhnliche Bewußtseinszustände – ihre gemeinsame Struktur und Messung, in: A. Dittrich, A. Hofmann, H. Leuner: Welten des Bewußtseins, Band 3, a.a.O., S. 45-58.

B. Fässler: Drogen zwischen Herrschaft und Herrlichkeit. Der Umgang mit Drogen im Spiegel der Gesellschaft, Solothurn 1997, S. 47, 99.

L. Hermle, E. Gouzoulis, K.A. Kovar, D. Borchard: Zur Bedeutung der historischen und aktuellen Halluzinogenforschung in der Psychiatrie am Beispiel Arylalkanamin-induzierter Wirkungen bei gesunden Probanden, in: A. Dittrich, A. Hofmann, H. Leuner: Welten des Bewußtseins, Band 3, a.a.O., S. 159.

W.N. Pahnke: Drugs and Mysticism, in: B Aaronson, H. Osmond: Psychedelics, New York 1970, S. 147ff.

A. Dittrich, D. Lamparter: Differenzielle Psychologie außergewöhnlicher Bewußtseinszustände – Ergebnisse experimenteller Untersuchungen mit sensorischer Deprivation, N,N-Dimethyltriptamin, in: A. Dittrich, A. Hofmann, H. Leuner: Welten des Bewußtseins, Band 3, a.a.O., S.75ff.

G. Klein: electronic vibration. Pop Kultur Theorie, Hamburg 1999, S.221f.

P. Märtens: Stoff-Checking, Safer-Use, Info-Mobil: Erfahrungen der DROBS Hannover, in: BOA e.V. (Hg.): Pro Jugend – Mit Drogen? »Mein Glück gehört mir!«, Solothurn 1998, S. 165 - 170.

G. Rakete, U. Flüsmeier: Der Konsum von Ecstasy – Empirische Studie zu Mustern und psychosozialen Effekten des Ecstasykonsums, herausgegeben von der Hamburgischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. im Auftrag der BZgA, Hamburg 1997, S.71.

T. Leary, G.H. Litwin, R. Metzner: Reactions to Psilocybin Administered in a Supportive Environment, in: Journal of Nervous & Mental Diseases, Vol. 137 No. 6, December 1963.

T. Leary: Introduction. The Psychological Situation, in: D. Solomon (Hg.): LSD: The Consciousness-Expanding Drug, New York 1966, S.22.

D. Leu: Drogen. Sucht oder Genuß, 3. überarbeitete Auflage, Basel 1984, S.117f.

G. Barsch: Drogen machen Angst, in: Fachverband Drogen und Rauschmittel (FDR) e.V. (Hg.): Sucht macht Angst. Dokumentation 16. Bundesdrogenkongreß, Geesthacht 1994, S.34.

N. Saunders: Ecstasy und die Tanz-Kultur, Solothurn 1998, S.117.

Kassationshof des Schweizerischen Bundesgerichts: Urteil vom 21. April 1999, Gesch.-Nr. 6S.288/1998/rei, Lausanne 1999, S.17.

B. Roques: Probleme durch das Gefahrenpotential von Drogen, Bericht der Kommission unter Leitung von Professor Bernard Roques für den Französischen Staatssekretär für Gesundheit (Übersetzung aus dem Französischen: Bundessprachenamt – Referat SM II 2), Paris 1998; Vgl.: H. Schuh: Alkohol – Opium fürs Volk. Wie französische Wissenschaftler die Gefährlichkeit der gängigsten Suchtmittel bewerten, in: Die Zeit Nr. 28 vom 2. Juli 1998, S.31.

Kassationshof des Schweizerischen Bundesgerichtes: Urteil vom 21. April 1999 (Gesch.-Nr. 6S.288/1998/rei), a.a.O., S.3.

Quelle: Roques-Report, zusammengestellt und abgedruckt in: H. Schuh: Alkohol – Opium fürs Volk. Wie französische Wissenschaftler die Gefährlichkeit der gängigsten Suchtmittel bewerten, in: Die Zeit Nr. 28/1998 vom 2. Juli.1998, S.31.

I: R. Brenneisen, H.J. Helmlin (Gutachten des Pharmazeutischen Instituts der Universität Bern vom 4. Feb. 1994);
II: Ch. Giroud (Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Lausanne vom 23. Juni 1994);
III: T. Breillmann (Gutachten des Gerichtsmedizinischen Laboratoriums Basel-Stadt vom 29. September 1994;
IV: W. Bernard, J. Huber (Empfehlungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern vom Februar 1997);
V: F.X. Vollenweider (Gutachten der Forschungsabteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich vom 2. Mai 1997);
VI: A. Pasi (Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel vom 8. November 1997).
Bundesgerichtshof: Urteil vom 9. Oktober 1996 – 3 Str 220/96, in: Monatsschrift für Deutsches Recht Heft 1/1997, S.83.

Eve & Rave e.V. Berlin: Tanzparaden und Sicherheit, Pressemitteilung vom 13. August 1999, Berlin 1999.

Bündnis 90/Die Grünen (Hg.): Ecstasy und Techno, Informationen zur Wirkung, den gesundheitlichen Risiken und den gesundheitlichen Folgen des Ecstasykonsums sowie Forderungen zur Verbesserung der Situation für User von Partydrogen, vierte Auflage, Berlin 1998, S.7f.

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Kapiteln Dosisabhängigkeit bis einschließlich Setting beziehen sich auf nachfolgend genannte Literatur, sofern Textpassagen nicht besonders kenntlich gemacht sind:
E. Gouzoulis-Mayfrank, L. Hermle, K.-A. Kovar und H. Saß: Die Entaktogene "Ecstasy" (MDMA), "Eve" (MDE) und andere ringsubstituierte Methamphtaminderivate, in: Nervenartzt Nr. 67/1996, S. 369-380.
K.A. Kovar: Ecstasy: Status quo des pharmakologisch/medizinischen Forschungsstandes, in: Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (Hg.): Prävention des Ecstasykonsums. Empirische Forschungsergebnisse und Leitlinien. Dokumentation eines Statusseminars der BZgA vom 15. Bis 17. September 1997 in Bad Honnef, 1998, Köln 1998, S. 38-44.
R.M. Julien: Drogen und Psychopharmaka, Heidelberg, Berlin, Oxford 1997.
Hartke, H. Hartke, E. Mutschler, G. Rücker, M. Wichtel (Hg.): DAB 10 – Kommentar. Wissenschaftliche Erläuterungen zum Deutschen Arzneibuch, 10. Ausgabe (DAB 10): Amphetaminsulfat: Monographie A 30, 2. Lfg. Stuttgart 1993; Methamphetaminhydrochlorid: Monographie M 47, 4. Lfg. Stuttgart 1994; Cocainhydrochlorid: Monographie C 93, 2. Lfg. Stuttgart 1993.
L. Yensen: Perspectives on LSD and psychotherapy: the search for a new paradigm, in: Alfred Pletscher, Dieter Ladewig: 50 Years of LSD, Current status and perspectives of hallucinigens, London und New York 1994, S.191-202.
L. Yensen, D. Dryer: Dreißig Jahre psychedelische Forschung: Das Spring Grove Experiment und seine Folgen, in: Welten des Bewußtseins, Band 4 (Bedeutung für die Psychotherapie), Berlin 1994, S.155-187.
T. Harrach: "Vom Pilz verzaubert". Über den Gebrauch der Zauberpilze bei spirituellen Ritualen der Ur- und Naturvölker bis zum Einsatz in der Technoszene. Dosiswirkung der Pilzhalluzinogene, in: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.): Biogene Drogen – eine neue Gefahr? Dokumentation der Fachtagung vom 26. Februar 1998 in Glanerburg (NL), Münster 1998, S. 7-34.
A. Barth: Tödlich guter Stoff, in: Der Spiegel Nr. 5/1997, S. 37; Vgl.: o.A.: Gleich tödlich, in: Der Spiegel Nr. 33/1996, S.57.

Eve & Rave e.V. Berlin: Drug-Checking-Listen, Berlin und Solothurn 1995, 1996, 1997, 1998; Vgl.: Eve & Rave e.V. Berlin (Hg.), H. Ahrens, K. Fischer, T. Harrach, J. Kunkel: Partydrogen 97’. safer use zu ecstasy, speed, kokain, lsd und zauberpilzen, a.a.O., S.10ff.

K.A. Kovar: Drogen in der Szene: Cannabis, Arzneistoffe und Ecstasy, in: Pharmazeutische Zeitung Nr. 21/1995, S.13; Vgl.: A. Uchtenhagen: Arten, Funktionen und Wirkungen der Drogen (Psychopharmakologie und Toxikologie): Ecstasy, in: A. Kreuzer (Hg.): Handbuch des Betäubungsmittelstrafrechts, München 1998, S.23.

Presse und Informationsdienst der Bundesregierung: Politik gegen Drogen, a.a.O., S.6.

S. Herre, F. Pragst, B. Rießelmann, S. Roscher, J. Tencer, E. Klug: Zur toxikologischen Bewertung der Lokalanästhetika Lidocain und Tetracain bei Drogentodesfällen, in: Rechtsmedizin Nr. 9/1999, S.174-183.

B. Rießelmann: Lodicain und Drogentodesfälle, in: Rundschreiben Apothekenkammer Berlin Nr. 1/1999, S.11.

o.A.: Dealer Strecken Drogen mit Lidocain, in: Pharmazeutische Zeitung Nr. 34/1998.

S. Herre, F. Pragst, B. Rießelmann, S. Roscher, J. Tencer, E. Klug: Zur toxikologischen Bewertung der Lokalanästhetika Lidocain und Tetracain bei Drogentodesfällen, in: Rechtsmedizin Nr. 9/1999, S.174.

R. Thomasius, M. Schmolke, D. Kraus: Folgeerkrankung bei Ecstasy, in: J. Gölz (Hg.): Moderne Suchtmedizin, Diagnostik und Therapie der somatischen, psychischen und sozialen Probleme, Stuttgart 1998, S.6 C 4.4.

| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
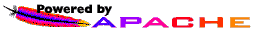

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |