Drug-Checking-Konzeptfür die Bundesrepublik Deutschland
|
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
Drug-Checking-Konzept
für die
Bundesrepublik Deutschland
Konzeptioneller Vorschlag
zur Organisation von
Drug-Checking
Eine Diskussionsgrundlage
-
Interventionsstrategien
-
Modellvarianten in der Schweiz
In der Schweiz wurde zu Beginn der 90er Jahre ein Richtungswechsel von einer äußerst repressiven Drogenpolitik hin zu einer Politik mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung vollzogen. Nirgends sonstwo manifestierten sich die negativen Folgen einer harten Repressionspolitik so deutlich wie in der Schweiz. Es gab dort in Relation zur Einwohnerzahl mehr sogenannte "Drogentote" als in allen anderen europäischen Staaten
 und auch
die Zahl der AIDS-Opfer lag in der Schweiz höher als in allen
umliegenden Nachbarländern
und auch
die Zahl der AIDS-Opfer lag in der Schweiz höher als in allen
umliegenden Nachbarländern  . Diese traurige Bilanz führte
zu einem Umdenken bezüglich der Maßnahmen die zu treffen
seien, um die im Zusammenhang mit dem Konsum von illegalisierten
Drogen stehenden Probleme besser managen zu können. Internationale
Beachtung fand hier vor allem die Einrichtung von Gesundheitsräumen
(Fixerstuben) wie auch die Abgabe von Heroin (Originalstoffvergabe)
an schwer Abhängige.
. Diese traurige Bilanz führte
zu einem Umdenken bezüglich der Maßnahmen die zu treffen
seien, um die im Zusammenhang mit dem Konsum von illegalisierten
Drogen stehenden Probleme besser managen zu können. Internationale
Beachtung fand hier vor allem die Einrichtung von Gesundheitsräumen
(Fixerstuben) wie auch die Abgabe von Heroin (Originalstoffvergabe)
an schwer Abhängige.In der Folge reduzierte sich die Zahl der sogenannten"Drogentoten"
 um 50 Prozent (1992 vermeldete
das Bundesamt für Polizeiwesen 419 Tote
um 50 Prozent (1992 vermeldete
das Bundesamt für Polizeiwesen 419 Tote  , 1998
waren es nur noch 210
, 1998
waren es nur noch 210  ). Trotz dieses Erfolges begleitet
der Suchtstoffkontrollrat (INCB) der Vereinten Nationen mit
Sitz in Wien die drogenpolitische Marschrichtung der Schweiz seit
Jahren mit großer Skepsis
). Trotz dieses Erfolges begleitet
der Suchtstoffkontrollrat (INCB) der Vereinten Nationen mit
Sitz in Wien die drogenpolitische Marschrichtung der Schweiz seit
Jahren mit großer Skepsis  .
.-
Drug-Checking in der Schweiz: Die Anfänge
Bereits 1992 wurde auf Regierungsebene die Forderung nach einer Qualitätskontrolle der auf dem Schwarzmarkt gehandelten Drogen gefordert. So stellte die Regierung (Regierungsrat) des Kantons Solothurn im Rahmen einer Eingabe (Motion) an den Schweizerischen Bundesrat (Bundesregierung) fest, daß die Qualität der angebotenen Drogen sehr unterschiedlich sei und nicht kontrolliert werden könne. Dies verhindere eine "richtige" Dosierung durch die Konsumenten und verursache die sogenannten Drogentoten. Da es die Aufgabe des Staates sei, das Zusammenleben der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu regeln und wo nötig, helfend und unterstützend einzugreifen, müsse eine Abkehr von der bisher verfolgten Prohibitionspolitik eingeleitet werden. So fordert die Regierung des Kantons Solothurn die Ausdehnung des Staatsmonopols, vergleichbar den Regelungen im Bereich von Tabak- und Alkoholprodukten, auch auf die illegalen Betäubungsmittel. So könne der Staat Anbau, Einfuhr, Handel und Vertrieb regeln und vor allem Preis- und Qualitätskontrollstellen einrichten. Zwar räumt die Solothurner Regierung ein, daß mit der Abkehr von der Prohibitionspolitik nicht die Abhängigkeitsprobleme von Drogen gelöst werden können, es sei jedoch möglich, einen kritischen und vernünftigen Umgang mit Suchtmitteln zu erlernen und dadurch innerhalb eines therapeutischen Ansatzes am wirklichen Problem, nämlich der Sucht, zu arbeiten
 .
.Es dauerte über zwei Jahre, wenn auch nicht ursächlich durch die Motion bedingt, bis die ersten Schritte zur Umsetzung der politischen Forderung nach Qualitätskontrolle von illegalisierten Substanzen realisiert wurden. Im Sommer 1995 führte die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme (ZAGJP) das erste Drug-Checking-Programm in der Schweiz durch.
-
Das ZAGJP-Modell
Im August 1995 vereinbarte die ZAGJP, eine von der Stadt Zürich subventionierte Einrichtung, mit dem Pharmazeutischen Institut der Universität Bern eine Zusammenarbeit zur qualitativen und quantitativen Analyse von Ecstasy-Pillen nach dem Vorbild von Eve & Rave in Berlin. In der Zeit von August bis November 1995 wurden insgesamt 19 Proben von der ZAGJP an das Institut weitergeleitet. Die Analyseergebnisse wurden der ZAGJP schriftlich mitgeteilt und in den Medien veröffentlicht.
Der vorzeitige Abbruch des Projektes wurde durch kommunalpolitische Auseinandersetzungen erzwungen, der in dem Vorwurf gipfelte, gegen geltendes Recht zu verstoßen
 .
In der Folge gab die ZAGJP ein Rechtsgutachten bei dem Basler
Strafgerichtspräsidenten in Auftrag, das die strafrechtlichen
Fragen in Zusammenhang mit der Analyse von Ecstasy-Tabletten
klären sollte. Zeitgleich mit der Veröffentlichung
dieses Gutachtens anläßlich einer Fachtagung der
Organisation Eve & Rave Schweiz in Zürich am 2. Juni
1997 wurde von einem Vertreter des Bundesamtes für Gesundheitswesen
(BAG) in Bern bekanntgegeben, daß
vom BAG ein Gutachten mit der gleichen Fragestellung in Auftrag
gegeben wurde
.
In der Folge gab die ZAGJP ein Rechtsgutachten bei dem Basler
Strafgerichtspräsidenten in Auftrag, das die strafrechtlichen
Fragen in Zusammenhang mit der Analyse von Ecstasy-Tabletten
klären sollte. Zeitgleich mit der Veröffentlichung
dieses Gutachtens anläßlich einer Fachtagung der
Organisation Eve & Rave Schweiz in Zürich am 2. Juni
1997 wurde von einem Vertreter des Bundesamtes für Gesundheitswesen
(BAG) in Bern bekanntgegeben, daß
vom BAG ein Gutachten mit der gleichen Fragestellung in Auftrag
gegeben wurde  . Beide
Gutachten kommen zu dem Schluß, daß das umstrittene
Testen von Ecstasy-Tabletten rechtlich zulässig ist,
sofern das Ziel im Schutz der Konsumenten begründet sei
und, daß es in strafrechtlicher Hinsicht keine Rolle spiele,
ob die Information über die Untersuchungsergebnisse mündlich
oder schriftlich erfolge. Wichtig sei nur, daß sich die
Information primär an die Konsumenten richte
. Beide
Gutachten kommen zu dem Schluß, daß das umstrittene
Testen von Ecstasy-Tabletten rechtlich zulässig ist,
sofern das Ziel im Schutz der Konsumenten begründet sei
und, daß es in strafrechtlicher Hinsicht keine Rolle spiele,
ob die Information über die Untersuchungsergebnisse mündlich
oder schriftlich erfolge. Wichtig sei nur, daß sich die
Information primär an die Konsumenten richte  . "Die
bloße wahrheitsgetreue, neutrale Information über
Risiken oder über die Zusammensetzung
(Menge und Art von Wirkstoffen) und Wirkungsweisen der verschiedenen
Produkte ist unproblematisch.
. "Die
bloße wahrheitsgetreue, neutrale Information über
Risiken oder über die Zusammensetzung
(Menge und Art von Wirkstoffen) und Wirkungsweisen der verschiedenen
Produkte ist unproblematisch.  " In
einer Stellungnahme des BAG zu den Gutachten wird bekanntgegeben,
daß die Ergebnisse der untersuchten Substanzproben systematisch
gesammelt werden sollen, um diese dann zu publizieren. Hierzu
habe die Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
bereits wichtige Schritte zu einer Koordination zwischen den
Laboratorien geleistet
" In
einer Stellungnahme des BAG zu den Gutachten wird bekanntgegeben,
daß die Ergebnisse der untersuchten Substanzproben systematisch
gesammelt werden sollen, um diese dann zu publizieren. Hierzu
habe die Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
bereits wichtige Schritte zu einer Koordination zwischen den
Laboratorien geleistet  .
.Nach der rechtlichen Klarstellung der Zulässigkeit von Ecstasy-Testings hat die ZAGJP auf eine erneute Aufnahme ihres Programms verzichtet. Wegen der Vorteile der Durchführung des Programms durch Selbstorganisationen, wurde dies an Eve & Rave Schweiz delegiert.
-
Die Praxis von Eve & Rave Schweiz
Das Pharmazeutische Institut der Universität Bern vereinbarte mit Eve & Rave Schweiz im Rahmen eines auf ein Jahr beschränkten, am 1. Januar 1997 beginnenden, Pilotversuchs, Ecstasy-Pillen qualitativ und quantitativ zu analysieren. Dieser zu Forschungszwecken durchgeführte Pilotversuch geschah nicht im Sinne eines Dienstleistungsauftrages, sondern war Bestandteil eines vom BAG unterstützten Forschungsprojektes "Ecstasy-Monitoring" gemäß vertraglicher Regelung vom 12. März 1996 zwischen dem BAG und dem Pharmazeutischen Institut der Universität Bern
 . Das Projekt wurde durch die öffentliche Hand finanziert.
Es entstanden somit keine Kosten für die an den Tests interessierten
Drogengebraucher, die ihre zu untersuchenden Proben zumeist
auf Parties an den Informationsständen den Mitarbeitern
von Eve & Rave Schweiz übergaben. Die Kosten für
die mit der Analytik verbundenen Infrastruktur (Entgegennahme,
Kodierung, Katalogisierung, Vermessung, Weiterleitung, etc.
der Pillen und die Veröffentlichung der Resultate in Listen)
wurden von Eve & Rave Schweiz übernommen. Im Jahr 1997
wurden weit über 250 Proben zur Untersuchung in das Institut
weitergeleitet. Verschiedentlich kamen mehrere Proben aus einer
Herstellungscharge ins Labor. In diesen Fällen ist nur
jeweils eine Probe in die Liste aufgenommen worden und in der
Statistik als nur eine einzige Probe erfaßt. Insgesamt
wurden 183 verschiedene Proben in den Pillenlisten erfaßt.
. Das Projekt wurde durch die öffentliche Hand finanziert.
Es entstanden somit keine Kosten für die an den Tests interessierten
Drogengebraucher, die ihre zu untersuchenden Proben zumeist
auf Parties an den Informationsständen den Mitarbeitern
von Eve & Rave Schweiz übergaben. Die Kosten für
die mit der Analytik verbundenen Infrastruktur (Entgegennahme,
Kodierung, Katalogisierung, Vermessung, Weiterleitung, etc.
der Pillen und die Veröffentlichung der Resultate in Listen)
wurden von Eve & Rave Schweiz übernommen. Im Jahr 1997
wurden weit über 250 Proben zur Untersuchung in das Institut
weitergeleitet. Verschiedentlich kamen mehrere Proben aus einer
Herstellungscharge ins Labor. In diesen Fällen ist nur
jeweils eine Probe in die Liste aufgenommen worden und in der
Statistik als nur eine einzige Probe erfaßt. Insgesamt
wurden 183 verschiedene Proben in den Pillenlisten erfaßt.Das Forschungsprojekt "Ecstasy-Monitoring" des BAG wurde nach Ablauf des Jahres 1997 nicht verlängert, so daß Eve & Rave Schweiz keine Analysen auf Staatskosten am Pharmazeutischen Institut der Universität Bern mehr in Auftrag geben konnte. Eve & Rave stellte jedoch das Drug-Checking-Programm nicht ein, sondern ließ die Analysen in verschiedenen zur Analytik von Betäubungsmitteln befugten Labors auf eigene Rechnung durchführen.
Das Vorhaben von Eve & Rave Schweiz wurde und wird von gesellschaftlichen Gruppen, wie zum Beispiel kirchlichen Institutionen, finanziell unterstützt. Die Ergebnisse der Analytik werden regelmäßig in Listen veröffentlicht und zudem auch seit April 1998 via Internet über eine eigens dafür eingerichtete Homepage
 dem Interessierten zugänglich
gemacht. Publikationen des Vereins beschränken sich jedoch
dem Interessierten zugänglich
gemacht. Publikationen des Vereins beschränken sich jedoch -
Das Modell der Stiftung Contact Bern
Die Stiftung Contact Bern ist eine privatrechtliche Institution, deren Stifterinnen allesamt öffentlich-rechtliche Körperschaften sind: die Bürgergemeinde Bern und Gemeinden aus der Region. Die Trägerschaft ist in drei Organe gegliedert (Stiftungsrat, Stiftungsausschuß und Revisionsstelle). Ein Stiftungsreglement bestimmt die Aufgaben und Kompetenzen. Im Stiftungsrat haben alle Mitgliedergemeinden einen Sitz (die Stadt Bern ist im Stiftungsrat mit zwei Sitzen repräsentiert). Zwei Sitze belegt der Kanton, der die Dienstleistungen und Projekte der Stiftung zum größten Teil subventioniert. Drei Vertreter/innen (mit Stimmrecht) werden von den Mitarbeiter/innen der Stiftung delegiert. Die Gemeinden wählen ihre Stiftungsräte-/innen selber. Sie entsenden entweder Chef- oder Fachbeamte-/innen oder Mitglieder des Gemeinderates oder der Fachkommissionen
 .
. Die Stiftung Contact erfüllt im Rahmen ihrer ambulanten Jugend-, Eltern- und Drogenarbeit verschiedene Aufgaben. Entsprechend vielfältig sind ihre Angebote und Dienstleistungen, die koordiniert und geleitet werden müssen. Eine dieser Dienstleistungen ist das Pilotprojekt Ecstasy. Das Pilotprojekt Ecstasy wird in Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern durchgeführt. Der Regierungsrat hat für das Projekt im Februar 1998 einen Betrag von 110 000 Franken bewilligt
 .
.Die Stiftung Contact will nicht allein statistische Daten über die Qualität der Drogen erheben und allenfalls konkrete Warnungen abgeben können – ihr Anliegen führt weiter. Im Vordergrund des Interesses steht hier vor allem die Frage, ob das Ecstasy-Testen auf Parties eine Möglichkeit darstelle, in Kontakt mit jugendlichen Drogenkonsumenten zu kommen. Die bisherige Erfahrung zeigt, daß mit den bekannten ambulanten Angeboten Jugendliche, die zwar Drogen konsumieren, aber noch keine sichtbaren Probleme haben, bisher nicht erreicht werden können. Der eigentliche Ecstasy-Test, von dem die Stiftung sich natürlich auch statistische Hinweise auf die Qualität der Drogen erhofft, bildet deshalb auch den Rahmen für die schwierige Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen. Mit dem Testangebot soll den Jugendlichen signalisiert werden, daß die Stiftung in einem ersten Schritt bereit ist, sie mit ihrem Drogenkonsum zu akzeptieren. Damit wird die Grundlage für den zweiten Schritt geschaffen, nämlich die unmißverständliche Vermittlung der Präventionsbotschaft: "Kein Drogenkonsum ist besser als jeder Drogenkonsum. Wer trotzdem Drogen konsumiert, soll dabei die Risiken möglichst gering halten."

Während die bisher vorgestellten und praktizierten Modelle eines Drug-Checking (mit Ausnahme der Apothekenpraxis) aus einem akzeptanzorientierten Ansatz heraus verstanden werden müssen, versteht die Stiftung Contact Bern ihr Engagement nicht primär in einem Beitrag zur Risikominimierung, sondern vor allem als ein innovatives Abstinenzprojekt. "Ziel des Projektes ist es, die Jugendlichen vom Ecstasykonsum abzuhalten. [...] Wir sind der Überzeugung, daß durch die ungeschminkte und sachliche Information der KonsumentInnen über die chemische Zusammensetzung ihrer Pillen das Bewußtsein für einen Konsumverzicht oder einen risikoärmeren und bewußteren Umgang mit der Substanz gefördert wird. Da aus Erfahrung ein Großteil der Pillen z.T. gesundheitsschädigende Derivate und Fremd- oder Strecksubstanzen enthalten, gehen wir davon aus, daß der Konsum der Pillen abnehmen wird. Wir hoffen, daß wir indirekt auch einen Einfluß auf den Ecstasy-Deal haben. Das heißt, daß das Testing die schlechten Pillen vom Markt verdrängt."

Da seitens der Stiftung Contact Bern die Ergebnisse der Analysen nicht veröffentlicht werden, sind die folgenden Fragen zu stellen:
-
Die Stiftung Contact Bern kommt zu der Erkenntnis, daß ein Großteil der Pillen eine schlechte Qualität aufweise und als gesundheitsschädlich zu klassifizieren sei. Warum werden diese Ergebnisse der Öffentlichkeit vorenthalten?
-
Müßte man nicht, um den erhofften Einfluß auf die Produktions- und Vertriebsszene zu erreichen, einen uneingeschränkten Informationszugang zu den Testresultaten sicherstellen?
-
Sollte einmal zum größten Teil nur noch "gute" Ware auf dem Schwarzmarkt erhältlich sein, dann kann nicht mehr argumentiert werden, daß eine Information der Konsumenten über die chemische Zusammensetzungen ihrer Pillen diese vom Konsum abzuhalten vermag. Damit wäre die Arbeitshypothese des Projekts ad absurdum geführt. Wie kann mit einer solchen Logik dauerhaft eine Vertrauensbasis zu Konsumenten aufgebaut und aufrecht erhalten werden?
Das Pilotprojekt Ecstasy "Pilot-e" ist als "Vor-Ort-Projekt" konzipiert. Die Pillentestung wird mittels eines mobilen Hoch-Leistungs-Flüssigkeitschromatographen (HPLC) an Partyveranstaltungen durchgeführt. Der Einsatz dieser Technik ermöglicht die qualitative und quantitative Pillenanalyse (Labortest) innerhalb eines Zeitraumes von nur fünfzehn Minuten
 .
.Trotz der Zusammenarbeit der Stiftung Contact mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern war es zunächst nicht möglich, die Vorortanalyse in der Stadt Bern durchzuführen. Der dortige Polizeidirektor hatte dagegen massiven Widerstand angekündigt. Mit einem Antrag an das Kantonalparlament zu einer gesetzlichen Regelung wurde versucht, das Pilotprojekt zu verhindern. Der Vorstoß löste eine kontroverse Drogendebatte im Kanton Bern aus. Schließlich lehnte das Kantonalparlament den Antrag mit einer knappen Mehrheit von 94 zu 89 Stimmen ab
 .
.In einem Kommentar zum Ausgang dieser drogenpolitischen Auseinandersetzung schreibt die Tageszeitung "Der Bund": "Mit dem Ecstasy-Entscheid des Großen Rates ist in der Drogenpolitik das Ende von Extrempositionen gekommen. Das langgewohnte Links-Rechts-Schema beginnt sich aufzuweichen. Durchgesetzt haben sich differenzierte Meinungen, nicht holzschnittartige Phrasen. [...] In der Drogenpolitik geht es um mehr als um Schwarz oder Weiß, erlaubt oder verboten, Repression oder Prävention – es gibt Zwischentöne und Gratwanderungen. Dazu gehören eben auch die Ecstasy-Tests, die keineswegs nur positive Seiten haben müssen."

-
-
______________________
Qualitätskontrollen sind moralische Pflicht!
"Man darf nicht weiterhin wissentlich zulassen,
daß sich Drogenkonsumenten vermeidbaren Risiken aussetzen.
Die Tatsache, daß Personen ein Verbot übertreten
(sei es moralischer oder rechtlicher Art), rechtfertigt nicht,
ihnen Hilfsmaßnahmen zu verweigern, die notwendig sind,
um die negativen Folgen ihres Verhaltens zu mildern. Dies insbesondere
dann nicht, wenn von dieser Hilfe ihre Gesundheit oder gar ihr
Leben abhängt. Die medizinische Ethik verlangt, daß
unabhängig von einer allfälligen Mißbilligung
eines Verhaltens eine Pflicht zur Hilfeleistung besteht, wenn
die Gesundheit einer Person gefährdet ist."
"Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit können von
vorübergehenden Natur sein, da sie mit einer bestimmten
Lebensphase und mit psychologischen oder sozialen Anpassungsschwierigkeiten
einhergehen. Es ist von großer Bedeutung, diesen Menschen
die Zukunft nicht zu verbauen und ihnen zu helfen, diese Phase
mit möglichst wenigen gesundheitlichen und sozialen Schäden
zu überstehen."
"Das zur Zeit auf nationaler und internationaler Ebene
angewandte repressive Kontrollsystem hat weder erlaubt, den
Drogenmarkt auszutrocknen, noch konnte damit der Zugang zu Drogen
wesentlich beschränkt werden. [...] Nichts deutet darauf
hin, daß von einem Ausbau dieses Systems eine erhöhte
Wirksamkeit erwartet werden könnte."
Zentralvorstand der Verbindung der Schweizer
Ärzte FMH:
FMH und Drogenpolitik, grundsätzliche Überlegungen
und ihre Konsequenzen für die Ärzteschaft,
in: Schweizerische Ärztezeitung, Band 77, Heft 9/1996 vom
28. Februar 1996.
Fussnoten:
-
Bundeskriminalamt: Rauschgiftjahresbericht Bundesrepublik Deutschland 1996, Wiesbaden 1997, Tab. 32.

-
World Health Organisation: Weekly Epidemiological Record, Nr. 31/1990, Genf 1990, S. 239.; Vgl. auch: World Health Organisation: Weekly Epidemiological Record, Nr. 27/1995, Genf 1995, S. 194.

-
A. Legnaro: "Drogen-Tod". Die empirische Realität eines sozialen Konstrukts, in: BINAD Nr.8/1997, S.9ff.

-
J. Rehm: Zur sozialen Lage der Drogenkonsument/-innen, in: H. Fahrenkrug et. al.: Illegale Drogen in der Schweiz: 1990 bis 1993; die Situation in den Kantonen und der Schweiz, herausgegeben von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA), Zürich 1995, S. 46.

-
SFA: Zahlen und Fakten zu Alkohol und anderen Drogen, Lausanne 1999, S.62.

-
M. Killias: Heroinabgabe und Schulmeisterei. Anmerkung zur Begleitmusik von WHO und INCB, in: Neue Zürcher Zeitung vom 3. Juni 1999.

-
Regierungsrat des Kantons Solothurn: Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Solothurn vom 8. Dezember 1992, Nr. 4041. Schreiben an den Bundesrat betreffend Legalisierung des Drogenkonsums und Betäubungsmittelmonopol (Revision des Betäubungsmittelgesetzes), Solothurn 1992, S.4 f.

-
M. Huber: Stadtrat verteidigt Ecstasy-Test. Kein Gesetzesverstoß der ZAGJP – ungewisse Zusammensetzung der Droge als Hauptrisiko, in: Tagesanzeiger vom 8. März 1996.

-
o.A.: Ecstasy-Tests sind rechtlich zulässig. Ähnliche Ergebnisse zweier Rechtsgutachten, in: Neue Zürcher Zeitung vom 3. Juni 1997.

-
P. Albrecht: Gutachten zu strafrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit den Ectasy-Testings, dokumentiert in: H. Cousto: Drug-Checking. Qualitative und quantitative Kontrolle von Ecstasy und anderen Substanzen, a.a.O., 1999, S. 187.

-
Hj. Seiler: Juristisches Gutachten für das Bundesamt für Gesundheit zu Rechtsfragen eines Ecstasy-Monitorings, dokumentiert in: H. Cousto: Drug-Checking. Qualitative und quantitative Kontrolle von Ecstasy und anderen Substanzen, a.a.O., S. 199 ff.

-
Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG): Die Haltung des BAG zu Pillentests und Ecstasy-Monitoring, Bulletin Nr.21 Bern 2. Juni 1997.

-
Bundesamt für Gesundheitswesen: Vertrag Nr. 316.93.0372, Bern 1996.

-
Stiftung Contact Bern: "contact" (Trägerschaft, Stiftungszweck, Organisation), Bern 1998, S.1f.

-
M. Müller: Drogenanalyse in einer Viertelstunde, in: Berner Zeitung vom 19. August 1998.

-
K. Jaggi: Pilotprojekt Ecstasy: Suchtprävention für Jugendliche an Parties, in: Pilot e: Suchtprävention für Jugendliche an Parties, Projektdokumentation Stiftung Contact Bern, Bern 1999, S.2f.

-
Stiftung Contact Bern: Ecstasyprojekt: Pilot-e. Pressetext, Bern 1998, S.1 f. [Hervorhebungen im Original].

-
Stiftung Contact Bern: Ecstasyprojekt: Pilot-e. Pressetext, Bern 1998, S.2.

-
o.A.: Ja zu den Ecstasy-Tests, in: Der Bund, Jg. 149 Nr. 270 vom 19. November 1998.

-
M. Suter: Das Ende extremer Positionen, in: Der Bund, Jg. 149 Nr. 270 vom 19. November 1998.

| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
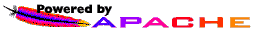

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |