Drug-Checking-Konzeptfür die Bundesrepublik Deutschland
|
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
Drug-Checking-Konzept für die Bundesrepublik Deutschland
Konzeptioneller Vorschlag
zur Organisation von
Drug-Checking
Eine Diskussionsgrundlage
-
Strukturbedingungen illegalisierter Märkte
Gebraucher illegalisierter Drogen sind, um ihre Konsumentscheidung
zu realisieren, auf den Schwarzmarkt angewiesen. Dieser
ist durch das Fehlen eines staatlichen Ordnungsrahmens charakterisiert
und entzieht sich so jenen gesellschaftlichen Kontrollen, die auf legalen
Märkten die Interessen der Beteiligten und Betroffenen schützen
 .
Grundsätzlich führt die Prohibition bestimmter Substanzen
zu folgenden Entwicklungen:
.
Grundsätzlich führt die Prohibition bestimmter Substanzen
zu folgenden Entwicklungen:
- Die Kontrolle über Hersteller und Vertreiber der jeweiligen Substanzen geht verloren;
- die Preise steigen und
- es besteht keine Sicherheit bezüglich der
Qualität der Substanz
 .
.
Hersteller und Händler illegalisierter Drogen
schützen sich vor möglicher Entdeckung, Verhaftung und Strafverfolgung,
indem am Handel beteiligte Personen so wenig wie möglich übereinander
wissen. Damit werden belastende Aussagen verhafteter Personen, die zu
einer Aufdeckung der Handelsstrukturen führen könnten, vermieden.
Mit diesem System wird jedoch in Kauf genommen, daß am Handel
beteiligte Zwischenhändler die Ware durch billige Zusatzstoffe
gewinnbringend strecken oder andere originär gesundheitsschädliche
Stoffe verkaufen. Auf anonymisierten Märkten sinkt die Hemmschwelle,
Konsumenten schlechte Qualität zu verkaufen. Im Bereich des Ecstasyhandels
traten die Probleme eines anonymisierten Schwarzhandels zunächst
nicht auf. Da die Ausgangsprodukte für die Ecstasyherstellung bis
zum Inkrafttreten des Grundstoffüberwachungsgesetzes
(GÜG) am 1. März 1995  erlaubnisfrei und unkontrolliert erworben werden konnten, entstanden
Produktions- und Vertriebswege mit Bezug zum Abnehmer. Der Dealer kannte
zumeist sowohl seine Kunden als auch den Hersteller der von ihm angebotenen
Produkte mit dem Resultat, daß die Reinheit der synthetischen
Drogen im Vergleich mit der von Heroin oder Kokain größer
war. Mit der starken Verbreitung von Ecstasy änderten sich auch
seine Vertriebssysteme. Der lukrative Markt der Partydrogenszene wurde
zunehmend von den "klassischen" Dealern übernommen, die
bereits die Heroin- und Kokainmärkte beherrschten. Sie verfügen
über das nötige Know-how und auch über die finanziellen
Mittel, um die Zielgruppe der Partydrogenkonsumenten
im Verdrängungswettbewerb für sich zu erschließen
erlaubnisfrei und unkontrolliert erworben werden konnten, entstanden
Produktions- und Vertriebswege mit Bezug zum Abnehmer. Der Dealer kannte
zumeist sowohl seine Kunden als auch den Hersteller der von ihm angebotenen
Produkte mit dem Resultat, daß die Reinheit der synthetischen
Drogen im Vergleich mit der von Heroin oder Kokain größer
war. Mit der starken Verbreitung von Ecstasy änderten sich auch
seine Vertriebssysteme. Der lukrative Markt der Partydrogenszene wurde
zunehmend von den "klassischen" Dealern übernommen, die
bereits die Heroin- und Kokainmärkte beherrschten. Sie verfügen
über das nötige Know-how und auch über die finanziellen
Mittel, um die Zielgruppe der Partydrogenkonsumenten
im Verdrängungswettbewerb für sich zu erschließen  .
Prohibitive Politik innerhalb der Partydrogen konsumierenden Szenen
wirkt sich demnach kontraproduktiv aus: "Anstelle
der überwiegend friedlichen und nicht gewaltbereiten Dealer, die
nicht in Banden organisiert sind und vornehmlich nur Ecstasy im Angebot
haben, auf die aber nicht zuletzt wegen ihrer unprofessionellen Arbeitsweise
ein relativ leichter polizeilicher Zugriff möglich ist, rücken
zunehmend ausländische, straff organisierte und auch vor Gewalt
nicht zurückschreckende Dealergruppen nach, die neben Ecstasy und
psychedelischen Drogen auch Kokain und Heroin anbieten und zudem auch
auf anderen Gebieten (Waffenhandel, Scheckkartenbetrug etc.) eine hohe
kriminelle Energie entwickeln und auf die letztlich Merkmale der organisierten
Kriminalität zutreffen
.
Prohibitive Politik innerhalb der Partydrogen konsumierenden Szenen
wirkt sich demnach kontraproduktiv aus: "Anstelle
der überwiegend friedlichen und nicht gewaltbereiten Dealer, die
nicht in Banden organisiert sind und vornehmlich nur Ecstasy im Angebot
haben, auf die aber nicht zuletzt wegen ihrer unprofessionellen Arbeitsweise
ein relativ leichter polizeilicher Zugriff möglich ist, rücken
zunehmend ausländische, straff organisierte und auch vor Gewalt
nicht zurückschreckende Dealergruppen nach, die neben Ecstasy und
psychedelischen Drogen auch Kokain und Heroin anbieten und zudem auch
auf anderen Gebieten (Waffenhandel, Scheckkartenbetrug etc.) eine hohe
kriminelle Energie entwickeln und auf die letztlich Merkmale der organisierten
Kriminalität zutreffen  ."
."
Für die Konsumenten ist der Verlust einer Qualitätskontrolle
mit ernsthaften Gefahren verbunden. Weder durch das Arzneimittelgesetz
(AMG), noch durch das Lebensmittelgesetz werden
die Gebraucher illegalisierter psychoaktiver Substanzen geschützt
 . Somit besteht keinerlei Gewähr dafür, daß
die von den im Untergrund wirkenden Drogenküchen hergestellten
und von Schwarzmarkthändlern angebotenen Substanzen chemisch rein
sind, das heißt keine durch den Produktionsprozeß eventuell
entstandenen Verunreinigungen enthalten oder überhaupt die gewünschte
Substanz beinhalten. Auch besteht keinerlei Wissen über die Konzentration
des Wirkstoffes
. Somit besteht keinerlei Gewähr dafür, daß
die von den im Untergrund wirkenden Drogenküchen hergestellten
und von Schwarzmarkthändlern angebotenen Substanzen chemisch rein
sind, das heißt keine durch den Produktionsprozeß eventuell
entstandenen Verunreinigungen enthalten oder überhaupt die gewünschte
Substanz beinhalten. Auch besteht keinerlei Wissen über die Konzentration
des Wirkstoffes  .
.
Beispielsweise die zur Streckung von Ecstasypulver
benutzten Stoffe bei der Darreichungsform in Kapseln, mangelhafte Synthesen
in der Produktion und die Unsicherheit über die Dosierung der Wirkstoffe
in den Ecstasypillen stellen Gefährdungspotentiale für die
Konsumenten dar. So führt Fromberg das Auftreten
akuter Lebervergiftungen nach Ecstasykonsum auf das Vorhandensein von
Verfälschungen und toxischen Nebenprodukten in Ecstasypillen zurück
 .
.
Ein weiteres Problem stellen die unterschiedlichen
Wirkstoffkonzentrationen dar. Wird von einer Einzeldosierung
von 80 bis 150 mg MDMA für einen erwachsenen Menschen ausgegangen
 , so könnte es durch die unterschiedlich hohen Dosierungen der
Pillen auf dem Schwarzmarkt zu gesundheitsgefährdenden Überdosierungen
kommen. Nimmt man zum Beispiel an, ein Konsument erwirbt drei Ecstasypillen
mit einer Wirkstoffkombination von je 30 mg, so wird er nach der
Einnahme einer solchen Pille die von ihm erwartete Wirkung nicht spüren
können. Nach einer Stunde wird er vermutlich eine weitere Pille
zu sich nehmen, da der erhoffte Erlebnisgewinn ausbleibt. Auch nach
dieser erneuten Einnahme ist die Wirkstoffkonzentration für ein
intensives Erleben noch zu gering. Wahrscheinlich wird er nach einer
weiteren Stunde die dritte Pille einnehmen. Erst jetzt ist mit einer
Dosierung von 90 mg MDMA ein leichter Rauschzustand für den
Konsumenten spürbar. Ein Wochenende später kauft sich dieser
Konsument wieder drei dem Aussehen nach ähnliche Pillen vom selben
Händler. Doch nun weisen die von ihm erworbenen Pillen eine Einzeldosis
von je 100 mg auf. Seine Erfahrungen vom vorangegangenen Wochenende
werden ihn vielleicht dazu animieren, gleich zwei oder alle drei Pillen
auf einmal zu konsumieren. In diesem Fall läge
er mit seiner Konzentration von 200 mg bzw. 300 mg erheblich über
der üblichen Einzeldosierung und befände sich nahe einer toxischen
Gefährdung durch den Wirkstoff
, so könnte es durch die unterschiedlich hohen Dosierungen der
Pillen auf dem Schwarzmarkt zu gesundheitsgefährdenden Überdosierungen
kommen. Nimmt man zum Beispiel an, ein Konsument erwirbt drei Ecstasypillen
mit einer Wirkstoffkombination von je 30 mg, so wird er nach der
Einnahme einer solchen Pille die von ihm erwartete Wirkung nicht spüren
können. Nach einer Stunde wird er vermutlich eine weitere Pille
zu sich nehmen, da der erhoffte Erlebnisgewinn ausbleibt. Auch nach
dieser erneuten Einnahme ist die Wirkstoffkonzentration für ein
intensives Erleben noch zu gering. Wahrscheinlich wird er nach einer
weiteren Stunde die dritte Pille einnehmen. Erst jetzt ist mit einer
Dosierung von 90 mg MDMA ein leichter Rauschzustand für den
Konsumenten spürbar. Ein Wochenende später kauft sich dieser
Konsument wieder drei dem Aussehen nach ähnliche Pillen vom selben
Händler. Doch nun weisen die von ihm erworbenen Pillen eine Einzeldosis
von je 100 mg auf. Seine Erfahrungen vom vorangegangenen Wochenende
werden ihn vielleicht dazu animieren, gleich zwei oder alle drei Pillen
auf einmal zu konsumieren. In diesem Fall läge
er mit seiner Konzentration von 200 mg bzw. 300 mg erheblich über
der üblichen Einzeldosierung und befände sich nahe einer toxischen
Gefährdung durch den Wirkstoff  .
.
_________________________
Drogenpolitik
"Die beiden Imperative, die das gesellschaftliche Drogenverhalten grundlegend bestimmen, das Konsumgebot des Marktes und das Konsumverbot der Prohibition, weisen unverkennbar in entgegengesetzte Richtungen. Die Drogenprohibition, die den Markt einschränken oder sogar ausschalten will, erzeugt wieder einen neuen Markt, der ganz den Marktimperativen folgt und dessen ohnehin schon schwarze Seiten durch die Bedingungen der Illegalität noch weiter verdunkelt werden.
Prohibition und Schwarzmarkt nehmen dem Individuum und der Gemeinschaft Kompetenzen weg, enteignen sie, berauben sie des genauen Wissens um die Droge und der freien Entscheidung für oder gegen sie. Verführung und Verbot rechnen gleichermaßen mit dem schwachen Individuum und der zerstörten Gemeinschaft, setzen sie ebenso voraus wie sie sie erzeugen. Rücksichtsloser Absatz und rücksichtslose Verfolgung nehmen das Individuum nicht mehr als Zweck; für sie ist es nur ein Mittel, durch welches sie ihre eigenen Zwecke verfolgen."
Sinngemäß zitiert nach: Christian Marzahn: Bene Tibi – Über Genuß und Geist, S. 18 f.
Fussnoten:
-
Vgl. zu den Interessenstrukturen auf illegalen Märkten: K.-H. Hartwig, I. Pies: Rationale Drogenpolitik in der Demokratie. Wirtschaftswissenschaftliche und wirtschaftsethische Perspektiven einer Heroinvergabe, Tübingen 1995, S.60ff.

-
J. Neumeyer, H. Schmidt-Semisch: Für das Recht auf Genuß – Ecstasy legal, in: J. Neumeyer, H. Schmidt-Semisch (Hg): Ecstasy – Design für die Seele?, Freiburg 1997, S.272.

-
Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung (Hg.): Politik gegen Drogen, Bonn 1996, S.4.

-
B. van Treeck: Gesellschaftspolitische Aspekte im Umgang mit Partydrogen, in: B. Van Treeck (Hg.): Partydrogen. Alles Wissenswerte zu Ecstasy, Speed, LSD, Cannabis, Kokain, Pilzen und Lachgas, Berlin 1997, S. 50 f; Vgl. zu Produktion und Handel von Ecstasy: J. Neumeyer: Die Enfants terribles der Drogenpolitik. Interviews mit Dealern und einem Produzenten, in: J. Neumeyer, H. Schmidt-Semisch (Hg): Ecstasy – Design für die Seele?, a.a.O., S.119-147.

-
J. Kunkel, J. Neumann: Tausend Mark ...Geldstrafe für eine Pille. Wollen Politik und Justiz nun auch die Technoszene mit Kriminalisierung und Verfolgung überziehen, also einen Weg beschreiten, der sich schon im Umgang mit Heroin als wenig hilfreich erwiesen hat?, in: Aktuell. Magazin der Deutschen AIDS-Hilfe, Nr.13 Berlin 1995, S.20.

-
J. Neumeyer, H. Schmidt-Semisch: Für das Recht auf Genuß – Ecstasy legal, in: J. Neumeyer, H. Schmidt-Semisch (Hg): Ecstasy – Design für die Seele?, a.a.O., S.273.

-
H. Cousto: Vom Urkult zur Kultur. Drogen und Techno, Solothurn 1995, S.159.

-
E. Fromberg: Die Pharmakologie und Toxikologie von MDMA, in: J. Neumeyer, H. Schmidt-Semisch (Hg): Ecstasy – Design für die Seele?, a.a.O., S.163.

-
H. Cousto: Drug-Checking. Qualitative und quantitative Kontrolle von Ecstasy und anderen Substanzen, zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage, Solothurn 1999, S.95.

-
P. Märtens: Angebote und Erfahrungen des Jugend- und Drogenberatungszentrums Hannover auf Raves – Drobs-Info-Mobil, Aufklärungsmaterialien und Pillenidentifikation, in: M. Rabes, W. Harm (Hg.): XTC und XXL. Ecstasy. Wirkungen, Risiken, Vorbeugungsmöglichkeiten und Jugendkultur, Reinbeck bei Hamburg 1997, S.193.

| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
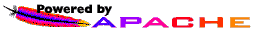

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |