Drug-Checking-Konzeptfür die Bundesrepublik Deutschland
|
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
Drug-Checking-Konzept für die Bundesrepublik Deutschland
Konzeptioneller Vorschlag
zur Organisation von
Drug-Checking
Eine Diskussionsgrundlage
-
Chemische, immunologische und instrumentelle Analysemethoden
auch Abschnitte 2.II.i und 2.III.i]
In diesem Abschnitt werden verschiedene analytische Methoden, die für Drug-Checking eingesetzt werden können, beschrieben und bewertet. Auf die Darstellung analytischer Details wird dabei weitgehend verzichtet, es werden vielmehr die Leistungsfähigkeit und die Defizite der Methoden hinsichtlich einer Anwendung beim Drug-Checking betrachtet. Zunächst wird die begrenzte Aussagekraft von Schnelltests im Drug-Checking-Prozeß herausgestellt. Eine Mittelstellung nehmen einfache DC-Methoden (Fachbegrifferläuterungen s.u.) und die Ionenmobilitätsspektroskopie (IMS) ein, die eine Identifizierung von Einzelsubstanzen erlauben, ohne daß eine Quantifizierung vorgenommen wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung und der Bewertung quantitativer HPLC- und GC/MS-Methoden, die bei verschiedenen europäischen Drug-Checking-Programmen bereits zur Anwendung kamen bzw. kommen. Abschließend wird die Anwendung von naher Infrarotspektroskopie (NIR) als innovative Methode vorgestellt, die eine Identifizierung und Quantifizierung einzelner Substanzen direkt aus komplexen Matrices ohne vorangehende zeitaufwendige Trennung ermöglicht.
-
Schnelltests
Eine Reagens-Flüssigkeit wird direkt auf einen kleinen Teil (Abrieb) der Drogenzubereitung getropft. Es erfolgt keine Auftrennung in die einzelnen Bestandteile. Hier handelt es sich um ein unspezifisches rein qualitatives Nachweisverfahren – es reagieren Molekülteilstrukturen, die in einer oder mehrerer Gruppen von Verbindungen vorhanden seien können (Gruppennachweis). Eine Quantifizierung der Substanzen ist nicht möglich. Substanzgemische können als solche nicht erkannt werden, was zu einer Fehlinterpretation des Ergebnisses führen kann. Verunreinigungen, auch durch pharmakologisch (hoch) wirksame Verbindungen, werden ebenfalls nicht erkannt.
Schnelltests werden als Identitätsnachweis (und nicht als Reinheits- oder Gehaltsbestimmung) für pharmazeutische Grundstoffe von den Arzneibüchern vorgeschrieben, und im gewissen Umfang von Apotheken und der pharmazeutischen Industrie durchgeführt. Schnelltests lassen sich im Prinzip von jedem Drogenkonsumenten "zu Hause" durchführen und haben dann unter anderem den didaktischen Wert, daß ein Drogengebraucher motiviert wird, sich mit der möglichen Zusammensetzung seiner Droge intellektuell auseinanderzusetzen. Eine Anleitung dazu und die Aufklärung über die beschränkte Aussagekraft solcher Schnelltests sollte durch einen Beipackzettel, einen Apotheker oder einen geschulten Szenemultiplikator erfolgen. Ein Schnelltest ist lediglich eine unbefriedigende Übergangslösung, solange in bestimmten Regionen keine qualifizierten Möglichkeiten zum Drug-Checking angeboten werden.
Schnelltests als theatralische Show zum Ködern von "Konsumenten" zwecks anschließender "Pillenidentifikation" und/oder zwecks Anbahnung eines Beratungsgespräches sind abzulehnen.
Rechtliche Hinweise:
Der Umgang mit Chemikalien muß den Normen des Gefahrenstoffrechts, insbesondere der Gefahrenstoffverordnung entsprechen. Seit dem 1.
November 1993 wird in der Bundesrepublik Deutschland das Inverkehrbringen
von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen in der Chemikalien-Verbots-Verordnung
geregelt.
Seit dem 1.
November 1993 wird in der Bundesrepublik Deutschland das Inverkehrbringen
von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen in der Chemikalien-Verbots-Verordnung
geregelt.  Gefährliche Stoffe und Zubereitungen sind seitdem
entsprechend ihrer Eigenschaften nach § 4 a Gefahrenstoffverordnung
(GefStoffV)
Gefährliche Stoffe und Zubereitungen sind seitdem
entsprechend ihrer Eigenschaften nach § 4 a Gefahrenstoffverordnung
(GefStoffV) eingestuft und in einer "Liste der gefährlichen
Stoffe und Zubereitungen"
eingestuft und in einer "Liste der gefährlichen
Stoffe und Zubereitungen"  veröffentlicht. Diese Liste
enthält diejenigen gefährliche Stoffe, für die gemäß
der Richtlinie 67/548/EWG
veröffentlicht. Diese Liste
enthält diejenigen gefährliche Stoffe, für die gemäß
der Richtlinie 67/548/EWG  die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung
in der Europäischen Gemeinschaft beschlossen wurde.
die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung
in der Europäischen Gemeinschaft beschlossen wurde.Das Inverkehrbringen der als T+ (sehr giftig) und T (giftig) eingestuften Stoffe bedarf einer Erlaubnis nach § 2 Abs.1 der Chemikalien-Verbots-Verordnung durch die zuständige Behörde, im Großhandel einer Anzeige entsprechend § 2 Abs.5 Chemikalen-Verbotsverordnung. Die Erlaubnis zum Inverkehrbringen erhält, wer:
-
die Sachkunde nach § 5 Chemikalen-Verbotsverordnung nachgewiesen hat
-
die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt
-
mindestens 18 Jahre alt ist.
-
Marquis-Reagens
Formaldehyd-Schwefelsäure R (Marquis-Reagens) nach Deutschem
 und Europäischem Arzneibuch
und Europäischem Arzneibuch  dient zum Nachweis
von (unterschiedlich) substituierten Aromaten durch Verfärbung:
dient zum Nachweis
von (unterschiedlich) substituierten Aromaten durch Verfärbung:  Die Ecstasy-Wirkstoffe (MDMA, MDE, MDA, MBDB) reagieren nach
dem Betropfen mit der Reagenslösung blau-schwarz
Die Ecstasy-Wirkstoffe (MDMA, MDE, MDA, MBDB) reagieren nach
dem Betropfen mit der Reagenslösung blau-schwarz  , die Speedwirkstoffe
Amphetamin und Methamphetamin reagieren zu einem orange-braunen
Farbprodukt während 2C-B und verwandte Substanzen sich
nach Kontakt mit dem Marquis-Reagens gelb-grün verfärben.
, die Speedwirkstoffe
Amphetamin und Methamphetamin reagieren zu einem orange-braunen
Farbprodukt während 2C-B und verwandte Substanzen sich
nach Kontakt mit dem Marquis-Reagens gelb-grün verfärben. 
Das Marquis-Reagens wird im Rahmen der Pillenidentifizierung des niederländischen DIMS-Projektes und der DROBS Hannover eingesetzt. Mittlerweile wird das Marquis-Reagens im freien Handel als EZ-Test® angeboten; eine Reagens-Tube beinhaltet 0,2 ml Reagenslösung, ausreichend für circa drei bis vier Anwendungen und wird für 6-8 US Dollar im Internet angeboten.

Beim Ausbleiben einer Farbreaktion ist allenfalls gesichert, daß die Probe keinen Ecstasy-Wirkstoff, kein Speed und kein 2C-B enthält, aber nicht, daß überhaupt kein Wirkstoff vorhanden ist. Die untersuchte Probe kann eine für die Gesundheit gefährliche Substanz enthalten, die mit dem Marquis-Reagens keine Farbreaktion hervorruft.
-
Reaktion mit Simons-Reagens

Simons-Reagens ist eine wässrige Lösung von Acetaldehyd und Dinatriumpentacyanonitrosylferrat [II]
 .
Es ermöglicht den Nachweis einer sekundären Aminogruppe
.
Es ermöglicht den Nachweis einer sekundären Aminogruppe  .
Simons-Reagens wird im Deutschen Arzneibuch zur Identitätsbestimmung
von Ethanol vorgeschrieben. Dazu wird zunächst Ethanol
mit Kaliumdichromat zum Acetaldehyd oxydiert. Anschließend
wird in diesem Fall Piperidin als sekundäres Amin zugesetzt
.
Simons-Reagens wird im Deutschen Arzneibuch zur Identitätsbestimmung
von Ethanol vorgeschrieben. Dazu wird zunächst Ethanol
mit Kaliumdichromat zum Acetaldehyd oxydiert. Anschließend
wird in diesem Fall Piperidin als sekundäres Amin zugesetzt  ,
das die Reaktion von Acetaldehyd mit Dinatriumpentacyanonitrosylferrat
[II] zu einem blauen Farbkomplex katalysiert. Die sekundäre
Amine MDMA, MDE, MBDB und Methamphetamin lassen nach dem Betropfen
mit Simons-Reagens ebenfalls einen blauen Farbkomplex entstehen.
Beim Kontakt der Reagenslösung mit den primären Aminen
Amphetamin und MDA tritt keine Farbstoffbildung ein.
,
das die Reaktion von Acetaldehyd mit Dinatriumpentacyanonitrosylferrat
[II] zu einem blauen Farbkomplex katalysiert. Die sekundäre
Amine MDMA, MDE, MBDB und Methamphetamin lassen nach dem Betropfen
mit Simons-Reagens ebenfalls einen blauen Farbkomplex entstehen.
Beim Kontakt der Reagenslösung mit den primären Aminen
Amphetamin und MDA tritt keine Farbstoffbildung ein. -
Reaktion mit Gallussäure und mit konzentrierter Schwefelsäure

Mit Gallussäure und konzentrierter Schwefelsäure läßt sich das Vorhandensein einer Methylendioxystruktur (freisetzbarer Formaldehyd) nachweisen. Ein positiver Nachweis wird somit bei den gängigen Wirkstoffen aus der Ecstasy-Gruppe geführt. Die Anwendung dieses Reagens bringt keine zusätzlichen Informationen nach der Anwendung des Marquis-Reagens.
-
Immunologische Schnelltests
Als Schnelltest eignen sich besonders auch immunologische Schnelltests, da sie hoch selektiv und hochempfindlich sind – sie sind jedoch sehr teuer. Der Ausdruck "Schnelltest" ist in diesem Zusammenhang nicht sehr aufschlußreich. Genauer wäre "nicht instrumenteller Immunoassay", da die zugrundeliegende chemischen Reaktionen wie bei allen Immunoassays auf dem Prinzip der Antigen/Antikörperreaktion beruhen
 . Als Beispiel sei hier der Drugwipe®
der Firma Securetec (Ottobrunn) genannt. Vier Typen dieses "Teststreifens"
werden angeboten, mit jedem Typ läßt sich nur eine
spezifische Stoffgruppe nachweisen:
. Als Beispiel sei hier der Drugwipe®
der Firma Securetec (Ottobrunn) genannt. Vier Typen dieses "Teststreifens"
werden angeboten, mit jedem Typ läßt sich nur eine
spezifische Stoffgruppe nachweisen:  Typ-Cocain, Typ-Opiates,
Typ-Cannabis, Typ-Amphetamines (Amphetamin, MDMA, Methamphetamin).
Da der Drugwipe® Typ-Amphetamines nicht zwischen
Ecstasy- und Speed-Wirkstoffen unterscheiden kann, ist er als
Schnelltest in der Partydrogen-Analytik ungeeignet.
Typ-Cocain, Typ-Opiates,
Typ-Cannabis, Typ-Amphetamines (Amphetamin, MDMA, Methamphetamin).
Da der Drugwipe® Typ-Amphetamines nicht zwischen
Ecstasy- und Speed-Wirkstoffen unterscheiden kann, ist er als
Schnelltest in der Partydrogen-Analytik ungeeignet.
-
-
Screening-Methoden zur Identifizierung einzelner Substanze
-
Dünnschichtchromatographie (DC und HPTLC)
Durch eine Kombination von geeigneten Fließmitteln kann eine Auftrennung und anschließende Identifizierung der meisten Drogenwirkstoffe erfolgen
 . Substanz-identifizierungen
mit der DC-Methode können in jedem Apothekenlabor im Zeitraum
einer halben Stunde durchgeführt werden. Eine Voraussetzung
dafür ist das Vorhandensein der entsprechenden Referenzsubstanzen.
Neben Ausmessung der Laufstrecke der aufgetrennten Substanzen
kann die Identifizierung der Wirkstoffe durch Besprühen
nach Entwicklung der DC-Platte mit Marquis-, Simons- und/oder
Gallussäure/konzentrierter Schwefelsäure erfolgen.
Die DC ist eine Routinemethode für die gängigen Screening-Untersuchungen
in chemischen, industriellen, klinischen, pharmazeutischen,
biochemischen oder biologischen Laboratorien.
. Substanz-identifizierungen
mit der DC-Methode können in jedem Apothekenlabor im Zeitraum
einer halben Stunde durchgeführt werden. Eine Voraussetzung
dafür ist das Vorhandensein der entsprechenden Referenzsubstanzen.
Neben Ausmessung der Laufstrecke der aufgetrennten Substanzen
kann die Identifizierung der Wirkstoffe durch Besprühen
nach Entwicklung der DC-Platte mit Marquis-, Simons- und/oder
Gallussäure/konzentrierter Schwefelsäure erfolgen.
Die DC ist eine Routinemethode für die gängigen Screening-Untersuchungen
in chemischen, industriellen, klinischen, pharmazeutischen,
biochemischen oder biologischen Laboratorien. 
Eine Weiterentwicklung der DC ist die sogenannte Hochleistungs-DC oder High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC). Die Trennungen sind schärfer und werden in einer kürzeren Zeit, nach etwa zehn Minuten, erreicht. Ein gewichtiger Nachteil bei dem HPTLC-Verfahren ist die deutlich geringere Probenkapazität.

-
Ionenmobilitätsspektroskopie (IMS)
IMS ist ein mobiles Analysesystem, welches sich für die Identifizierung vor Ort eignet. IMS-Methoden zur Erkennung von Drogen und Arzneistoffen sind etabliert. Detektion und Identifizierung erfolgen anhand der charakteristischen Peaks und der zugehörigen relativen Driftzeiten. Die Methode ist hochempfindlich (LSD-tauglich), es können Substanzmengen in der Größenordnung Nanogramm und Picogramm erfaßt werden
 . Die IMS ist mit einem sehr hohen materiellen Aufwand
verbunden und ermöglicht nur die Ermittlung eines rein
qualitativen Ergebnisses.
. Die IMS ist mit einem sehr hohen materiellen Aufwand
verbunden und ermöglicht nur die Ermittlung eines rein
qualitativen Ergebnisses.
-
-
Instrumentelle Methoden zur qualitativen und quantitativen Analyse
-
Dünnschichtchromatographie
Die Dünnschichtchromatographie (DC bzw. HPTLC) mit anschließender instrumenteller Detektion durch Messung der diffusen Reflexion im UV-VIS Bereich mit einem Densitometer, auch Scanner genannt, erlaubt parallele Untersuchungen vieler Proben. Sie wird in der Auflösung, Spezifität der Detektion und der Reproduzierbarkeit der Trennung in der Regel durch HPLC-Methoden übertroffen. Diese Nachteile können durch Entwicklungen mit einer erzwungenen Fließmittelbewegung, wie in der Over Pressured Thin Layer Chromatographie (OPTLC) oder der Rotations Planar Chromatographie, teilweise überwunden werden
 . Eine DC-Methode mit reflektionsphotometrischer Detektion
wurde zur Bestimmung der Proben unter anderem im Niederländischen
DIMS-Projekt eingesetzt.
. Eine DC-Methode mit reflektionsphotometrischer Detektion
wurde zur Bestimmung der Proben unter anderem im Niederländischen
DIMS-Projekt eingesetzt. 
-
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
Die HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ist eine Standardmethode zur schnellen Trennung von Substanzgemischen. Die Trennung der einzelnen Substanzen erfolgt aufgrund unterschiedlicher physikalisch-chemischer Eigenschaften in einem Trennsystem bestehend aus einer Säule und Fließmittel unter hohem Druck. Für die Analytik von Drogen werden Trennsysteme vor allem zur Auftrennung der (basischen) Gruppe psychoaktiver Substanzen wie Amphetamin, Amphetaminderivate u.a., Kokain, Opioide und Tryptamine benötigt. Nach erfolgter Trennung werden die Substanzen durch photometrisch-, fluoreszenz-, oder elektrochemische Detektion erfaßt
 . Die HPLC erlaubt eine genaue Identifizierung
und Quantifizierung von Substanzen auch in komplexen Stoffgemischen.
Als besonders geeignet für die Identifizierung von Substanzen
haben sich Photodiodenarray-Detektoren bewährt, da diese
das gesamte UV-Spektrum zu jeder Zeit eines Analyselaufs registrieren.
. Die HPLC erlaubt eine genaue Identifizierung
und Quantifizierung von Substanzen auch in komplexen Stoffgemischen.
Als besonders geeignet für die Identifizierung von Substanzen
haben sich Photodiodenarray-Detektoren bewährt, da diese
das gesamte UV-Spektrum zu jeder Zeit eines Analyselaufs registrieren. 
HPLC-Methoden zum Drug-Checking wurden eingesetzt von:
-
Prof. Fritz Pragst am Gerichtsmedizinischen Institut der Humboldt Universität Berlin (Charité) für das Eve & Rave Drug-Checking-Programm. Die Trennung der zu untersuchenden Stoffe erfolgte ohne Lösungsmittel-Gradient (isokratisch), so daß ein geschlossener Fließmittelkreislauf erzeugt werden konnte. Das verwendete Lösungsmittel-Puffergemisch konnte auf diese Weise kostengünstig und umweltschonend immer wieder verwendet werden bis das "Hintergrundrauschen" auf Grund der Verunreinigung, zum Beispiel durch akkumuliertes Probenmaterial, nicht mehr tolerierbar war. Die von einem Photodiodenarray-Detektor aufgenommenen UV-Spektren wurden durch computermäßige Bibliothekssuche mittels einer UV-Spektrenbibliothek von mehr als 1700 toxikologisch relevanten Sunstanzen und anhand der Retensionszeiten identifiziert. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, daß das Gerichtsmedizinische Institut der Humboldt Universität eine eigene Datenbank aufgebaut hat und vertreibt. 1997 hatte sie bereits 1740 Einträge und im Jahr 2000 soll ein aktualisiertes Update mit 2500 Referenzspektren auf den Markt gebracht werden
 .
In bestimmten Fällen, zum Beispiel zur Unterscheidung
von MDE und MBDB wurde das HPLC-Ergebnis mit einer GC/MS Untersuchung
abgesichert.
.
In bestimmten Fällen, zum Beispiel zur Unterscheidung
von MDE und MBDB wurde das HPLC-Ergebnis mit einer GC/MS Untersuchung
abgesichert. 
-
Prof. Rainer Schmidt, Bereich Biopharmazeutische und Toxikologische Analytik, Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Neues AKH Wien, für das wissenschaftliche Pilot-Projekt ChEck iT! Es wurde eine sehr spezifische, speziell auf Amphetamine abgestimmte HPLC-Methode entwickelt und vor Ort auf Parties eingesetzt. Diese Methode ist in der Lage, innerhalb von vier Minuten Amphetamin und mehrere Amphetaminderivate (Methamphetamin, MDMA, MDA, MDE, MBDB) quantitativ zu bestimmen und weitere Amphetaminderivate qualitativ nachzuweisen (u.a. DOB, DOM). Da eine gleichzeitige Differenzierung aller Amphetamine voneinander und von anderen Stoffen nicht möglich ist, wird bei der Detektion eine Kombination von zwei Detektoren gewählt, die aufgrund der spektralen Eigenschaften der einzelnen Verbindungen zu ausreichenden Diskriminierungen imstande sind.
-
Gaschromatographie-Massenspektroskopie-Kopplung (GC/MS)
Nach gaschromatographischer Trennung werden die Bestandteile massenspektroskopisch detektiert. Für einzelne Peaks oder sogar ganze Chromatogramme können auch die vollständigen Massenspektren registriert werden. Die GC/MS Kopplung ist eine sehr präzise, hochempfindliche aber instrumentell aufwendige und teure Methode. Sie erlaubt eine sichere Identifizierung, Quantifizierung und Reinheitsbestimmung von Substanzen
 . Dem Massenspektrum können die Molekulare
Masse und Informationen zur Molekülstruktur von Verbindungen
entnommen werden
. Dem Massenspektrum können die Molekulare
Masse und Informationen zur Molekülstruktur von Verbindungen
entnommen werden  . GC/MS wurde von Prof. Pragst in dem Gerichtsmedizinischen
Institut der Charité (Humboldt-Universität Berlin)
bei Problemproben (nicht erwarteter Substanzen) und zur Absicherung
von bestimmten HPLC-Ergebnissen (sichere Unterscheidung von
MDE und MBDB) für das Eve & Rave Programm eingesetzt
und mit der MS-Bibliothek von Pfleger, Maurer und Weber mit
circa 5000 Einträgen abgeglichen
. GC/MS wurde von Prof. Pragst in dem Gerichtsmedizinischen
Institut der Charité (Humboldt-Universität Berlin)
bei Problemproben (nicht erwarteter Substanzen) und zur Absicherung
von bestimmten HPLC-Ergebnissen (sichere Unterscheidung von
MDE und MBDB) für das Eve & Rave Programm eingesetzt
und mit der MS-Bibliothek von Pfleger, Maurer und Weber mit
circa 5000 Einträgen abgeglichen  . Über GC-MS-Anlagen
verfügen in Deutschland alle Institute für Gerichtsmedizin
sowie die überwiegende Zahl der toxikologisch-analytisch
arbeitenden Laboratorien mit klinischer Zielstellung.
. Über GC-MS-Anlagen
verfügen in Deutschland alle Institute für Gerichtsmedizin
sowie die überwiegende Zahl der toxikologisch-analytisch
arbeitenden Laboratorien mit klinischer Zielstellung. -
Nahe Infrarot-Spektroskopie (NIR)
Die nahe Infrarot-Spektroskopie (NIR) ist eine Methode, die mit hohem Geräteaufwand und erst nach Etablierung (u.a. Kalibrierung) der Methode mit einem sehr kleinem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden ist. Seit den Sechziger Jahren wird NIR in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie eingesetzt. 1992 wurde die Methode von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zur Identifizierung, Wassergehaltsbestimmung und Prüfung von Ampicillintrihydrat genehmigt. Die Anwendung von NIR in der forensischen Analytik "steckt allerdings noch in den Kinderschuhen". Es handelt sich um eine leistungsfähige, sensitive Methode: Aus komplexen Gemischen und Matrizes zum Beispiel Pflanzenteilen oder Tabletten lassen sich bestimmte Komponenten direkt identifizieren. Eine besondere Bedeutung hat die quantitative Analyse im NIR-Bereich bekommen. Es lassen sich auf diese Weise die Gehalte an Fett oder Wasser in Lebensmitteln oder von Eiweiß in Getreide mit relativen Fehlern im Bereich von bis zu zwei Prozent bestimmen. Die NIR-Methode kann auch zur Bestimmung von Oktanzahlen in Benzinen verwendet werden
 .
Die Methode ist "nicht-destruktiv", das heißt
die Matrix braucht nicht zerstört oder beschädigt
werden und es wird dabei keine Substanz verbraucht. Da keine
Probenvorbereitung und Auftrennung der zu untersuchenden Substanzen
notwendig ist, erfolgt die Messung und die Ergebnisermittlung
bei einem kalibrierten System innerhalb einer Minute. Die Anwendung
dieser Methode ist nicht auf ein Labor beschränkt, das
Gerätevolumen entspricht in etwa dem von zwei Personalcomputern
.
Die Methode ist "nicht-destruktiv", das heißt
die Matrix braucht nicht zerstört oder beschädigt
werden und es wird dabei keine Substanz verbraucht. Da keine
Probenvorbereitung und Auftrennung der zu untersuchenden Substanzen
notwendig ist, erfolgt die Messung und die Ergebnisermittlung
bei einem kalibrierten System innerhalb einer Minute. Die Anwendung
dieser Methode ist nicht auf ein Labor beschränkt, das
Gerätevolumen entspricht in etwa dem von zwei Personalcomputern  .
Eine NIR-Methode zur Identifizierung von MDMA, MDE und Amphetamin
ist bereits entwickelt und validiert worden. Eine Unterscheidung
der drei Einzelsubstanzen direkt in der Tablettenmatrix nach
einer Pulverisierung der Probe ist möglich
.
Eine NIR-Methode zur Identifizierung von MDMA, MDE und Amphetamin
ist bereits entwickelt und validiert worden. Eine Unterscheidung
der drei Einzelsubstanzen direkt in der Tablettenmatrix nach
einer Pulverisierung der Probe ist möglich  . Erste Ergebnisse
weisen darauf hin, daß eine Identifizierung sogar aus
intakten Tabletten möglich ist.
. Erste Ergebnisse
weisen darauf hin, daß eine Identifizierung sogar aus
intakten Tabletten möglich ist. 
Über andere Stoffe erlaubt die Methode nur eine unsichere Aussage. Traten beim ChEck iT-Projekt Proben mit "Verunreinigungen" auf, die nicht zu den Amphetaminen gehörten, wurde die fragliche Probe einer eingehenderen Untersuchung mit dem REMEDi-System® unterzogen. Mittels dieses "Doppel-Systems" konnten folglich nur Amphetaminderivate, Methamphetamin, MDMA, MDA, MDE und MBDB quantifiziert werden. Die meisten anderen pharmakologisch aktiven Bestandteile konnten zumindest identifiziert werden. Saure Substanzen (wie Acetylsalicylsäure und Paracetamol) und strukturell einfache organische Verbindungen (z.B. Syntheseverunreinigungen) konnten durch das ChEck iT-System nicht erfaßt werden
 . Die Auswirkungen einer solchen "analytischen
Lücke" zeigten sich in der Tatsache, daß Togal
Schmerztabletten nur dann als "pharmakologisch wirksame Proben"
identifiziert werden konnten, wenn neben der großen Menge
von 500mg Acetylsalicylsäure (deutsche Togal) bzw. 247,8
mg Acetylsalicylsäure (österreichische Togal) noch zusätzlich
das nur in der österreichischen Variante und in der relativ
geringen Menge von 1,37 mg basischen Chinidin enthalten war.
. Die Auswirkungen einer solchen "analytischen
Lücke" zeigten sich in der Tatsache, daß Togal
Schmerztabletten nur dann als "pharmakologisch wirksame Proben"
identifiziert werden konnten, wenn neben der großen Menge
von 500mg Acetylsalicylsäure (deutsche Togal) bzw. 247,8
mg Acetylsalicylsäure (österreichische Togal) noch zusätzlich
das nur in der österreichischen Variante und in der relativ
geringen Menge von 1,37 mg basischen Chinidin enthalten war. 
Das REMEDi-Analysesystem® der Firma BioRad basiert auf dem HPLC-Prinzip und verfügt über eine große Datenbank, in der chromatographische und spektrale Eigenschaften von bisher 700 pharmakologisch relevanten Stoffen gespeichert sind, darunter fast alle (bekannten) illegalisierten Drogen und viele zugelassene Medikamente und deren Metaboliten. Das System benötigt zur Analyse einer Probe circa fünfzehn Minuten. Saure Verbindungen wie z.B. Acetylsalicylsäure (Aspirin) und Paracetamol sind von diesem System ebenso schwierig zu identifizieren, wie strukturell einfache organische Verbindungen.
Daniel Allemann vom Kantonsapothekeramt Bern konzeptionierte und realisierte eine "mobile HPLC-Apparatur" mit dem er im Rahmen des "pilot e" Projekts vor Ort Untersuchungen auf Parties im Kanton Bern in der Schweiz durchführte. Die Test-Apparatur funktioniert nach Aussage von Daniel Allemann sehr zuverlässig. Aufbau und Struktur dieses Systems sind im Anhang dargestellt.
[Siehe Anhang A-4]________________________
Von Drogen, Kultur und Genuß
"Es gibt Drogen, die in bestimmten Dosierungen den Geist und die Sinne anregen, die Wahrnehmung intensivieren und so auch die Genußfähigkeit steigern. Werden diese Drogen bewußt und zielgerichtet eingesetzt, können sie helfen, die Kunst des Genießens zu erlernen, wobei die Droge allein das nicht vermag, sondern es braucht dazu immer auch die eigene Initiative, eine bewußte Tätigkeit in einem dafür geeigneten Rahmen. Eine Gesellschaft, die in der Lage ist, für bestimmte drogeninduzierte Wahrnehmungsveränderungen den richtigen Rahmen zu schaffen ,damit diese lust- und genußvoll erlebt werden können und dabei auch dem Wohl aller Teilnehmenden förderlich sind, kann man mit Fug und Recht eine kultivierte Gesellschaft nennen. Eine so geprägte Gesellschaft läuft nicht Gefahr, viele süchtige Menschen hervorzubringen. In einer Gesellschaft hingegen, die solche Rahmenbedingungen zerstört, ist das Suchtpotential ungemein viel größer und die Gefahr von suchtbedingtem Elend ist kaum abwendbar."
Hans Cousto, Berlin 1997
-
Fussnoten:
-
H. Hügel, J. Fischer, B. Kohm: Pharmazeutische Gesetzeskunde, 31. Auflage, Stuttgart 1998, S. 549 ff.

-
Verordnung über Verbote und Beschränkung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz – Chemikalien-Verbotsverordnung – vom 14. Oktober 1993 (BGBL.I, S. 1720) in der Neufassung der Chemikalien-Verbotsverordnung vom 19. Juli 1996 (BGBL.I, S. 1151), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Dezember 1998 (BGBL.I, S. 3956).

-
Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrenstoffverordnung – GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 (BGBL.I, S. 1783), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Dezember 1998 (BGBL.I, S. 3956).

-
Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen nach § 4 a GefStoffV, zuletzt geändert am 7. März 1997 (Bundesanzeiger Nr. 110 a vom 19. Juni 1997), Vgl.: Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) in der Fassung vom 25. Juli 1994 (BGBL.I S. 1703), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Mai 1998 (BGBL.I, S. 950).

-
Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABI. EG v. 16.08.1967 Nr. 196, S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 97/69/EG v 5.12.1997 (ABI. EG Nr. L. 343, S. 19).

-
K. Hartke, H. Hartke, E. Mutschler, G. Rücker, M. Wichtel (Hg.): DAB – Kommentar. Wissenschaftliche Erläuterungen zum Deutschen Arzneibuch, 8. Lfg. 1997, Reagenzien F 5, Stuttgart und Frankfurt am Main 1997.

-
K. Hartke, H. Hartke, E. Mutschler, G. Rücker, M. Wichtel: Arzneibuch-Kommentar (M85) NT 1998, 11. Lfg., Stuttgart und Frankfurt am Main 1999, S. 2; Vgl.: K. Görlitzer, I.M. Weltrowski: Zur Reaktion von Morphin mit Formaldehyd, in: Pharmazie 52/1997, Heft 10, S. 744.

-
C. Rösch, K.A. Kovar: Synthetische Suchtstoffe der 2. Generation (sog. Designer Drugs). 2. Mitt.: Analytik der Arylalkylamine (Amphetamine), in: Pharmazie in unserer Zeit, Nr. 5/1990, S. 221. Vgl.: H.A. Dingjan, S.M. Dreyer von der Glas, G.T. Tjan: Colour test for the identification of alkaloids (and related compounds). A literature review and a study of colour changes in relation to time, in: Pharmaceutisch Weekblad Nr. 115/1980, S. 445-467.

-
B. von Kampen: Das Drogen-Informations-Monitoring-System (DIMS) in den Niederlanden, in: BINAD Nr. 8/1997, S. 5.

-
Gemäß Packungsbeilage zum EZ-Test, Sp@nk Products Amsterdam (http://www.ez-test.com).

-
C. Rösch, K.A. Kovar: Synthetische Suchtstoffe der 2. Generation (sog. Designer Drugs). 2. Mitt.: Analytik der Arylalkylamine (Amphetamine), in: Pharmazie in unserer Zeit, Nr. 5/1990, S. 221.

-
H.J. Roth, K. Eger, R. Troschütz: Arzneistoffanalyse, 2. Auflage, Stuttgart und New York 1985, S. 40.

-
C. Rösch, K.A. Kovar: Synthetische Suchtstoffe der 2. Generation (...), in: Pharmazie in unserer Zeit, Nr. 5/1990, S. 221.

-
Deutsches Arzneibuch, 9. Ausgabe 1986, Frankfurt am Main 1986, S. 785.

-
C. Rösch, K.A. Kovar: Synthetische Suchtstoffe der 2. Generation (...), in: Pharmazie in unserer Zeit, Nr. 5/1990, S. 221.

-
A. Scholer: Nicht-instrumentelle Immunoassays in der Suchtmittelanalytik (Drogenanalytik), in: Gesellschaft für toxikologische und forensische Chemie (Hg.): Toxichem + Krimtech, Bd. 66 Nr.1/1999, S. 28.

-
SECURETEC Sicherheitstechnologie und Gefahrstoffdetektion GmbH (Hg.): Anwendungshinweise für den Einsatz des Drogenschnelltests Drugwipe® bei Straßenverkehrskontrollen nach §24a StVG, Ottobrunn (ohne Jahrgang), S.3

-
J Wolf und Völker-Schule: Mikro-Dünnschichtchromatographie "Weckamine", in Pharmazeutische Zeitung Nr. 41/1995.

-
W. Katzung: Ionenmobilitätsspektrometer für die Erkennung und den Nachweis von gefährlichen Stoffen, in: F. Pragst (Hg.): Symposiumsband der Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (Symposium vom 22.-24. April 1999), Berlin 1999 (in Druck).

-
Aussage eines Laborleiters des DIMS-Projekt auf dem von der NIAD organisierten Drug-Checking-Treffen vom 15. und 16. Februar 1996 in Amsterdam.

-
Telephonische Auskunft von Prof. Pragst vom 30. September 1999.

-
M. Rothe, F. Pragst, K. Spiegel, T. Harrach, K. Fischer, J. Kunkel: Hair concentrations and self-reported abuse history of 20 amphetamine and ecstasy users, in: Forensic Science International 89/1997, S. 116.

-
H. Kriener, R. Schmidt, G. Smekal: ChEck iT! Bericht zum wissenschaftlichen Pilot-Projekt ChEck iT! mit Daten und Erfahrungen aus den Jahren 1997 und 1998, herausgegeben vom Verein Wiener Sozialprojekte, a.a.O., S 22.

-
M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh: Massenspektren, in: Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie, 3. Auflage, Stuttgart und New York 1987, S.197.

-
M. Rothe, F. Pragst, K. Spiegel, T. Harrach, K. Fischer, J. Kunkel: Hair concentrations and self-reported abuse history of 20 amphetamine and ecstasy users, in: Forensic Science International 89/1997, a.a.O., S.114.

-
N. Sondermann, K.A. Kovar: Identification of ecstasy in complex matrices using near-infrared spectroscopy, im: Forensic Science International, 102/1999, S.135.

-
Telefonische Auskunft von Ralf Schneider, Pharmazeutisches Institut der Universität Tübingen vom 30.09.1999

| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
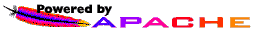

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |