Drug-Checking-Konzeptfür die Bundesrepublik Deutschland
|
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
Drug-Checking-Konzept für die Bundesrepublik Deutschland
Konzeptioneller Vorschlag
zur Organisation von
Drug-Checking
Eine Diskussionsgrundlage
-
Von der "Suchtprävention" zur Förderung von Drogenmündigkeit
-
Kritische Einführung in die Trias Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention
Die gerade im Bereich der Suchtprävention noch immer sehr verbreitete Binnendifferenzierung in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention, geht maßgeblich auf den amerikanischen Psychiater Gerald Caplan zurück. Mit primärer Prävention bezeichnet er allgemeine und spezifische gesundheitsförderliche Maßnahmen, die vor der Manifestwerdung von Symptomen diesen vorbeugen sollen. Sekundäre Prävention soll nach der Manifestwerdung von Symptomen versuchen, deren Verschlimmerung zu verhindern bzw. die Auswirkungen auf den Gesamtorganismus möglichst gering zu halten. Tertiäre Prävention schließlich setzt klassischerweise bei der Krankheitsrehabilitation bzw. der Verhinderung von Nachfolge- und Rückfallerkrankungen an. Interessant ist, daß der Mediziner Caplan dieses Konzept im Zusammenhang mit seiner Forschungsarbeit zur "Community Mental Health"
 entwickelte, die vor allem auf die Vorbeugung
von schweren Verhaltensstörungen und Geisteskrankheiten abzielte.
Hauptansatzpunkt
seines quasi generalpräventiven Konzeptes waren dabei die individuellen
und kollektiven (Problem-) Bewältigungsstrategien (coping strategies).
entwickelte, die vor allem auf die Vorbeugung
von schweren Verhaltensstörungen und Geisteskrankheiten abzielte.
Hauptansatzpunkt
seines quasi generalpräventiven Konzeptes waren dabei die individuellen
und kollektiven (Problem-) Bewältigungsstrategien (coping strategies). 
Überträgt man diese definitorischen Grundlagen auf den Bereich der Suchtprävention, läßt sich primäre Prävention als der Versuch beschreiben, ein Individuum oder eine Gruppe "vor" dem ersten Kontakt mit einem Rauschmittel zu einem bestimmten Umgang mit diesem (im Sinne des Abstinenzparadigmas also beispielsweise zur konsequenten Meidung illegalisierter Rauschmittel) zu erziehen. Sekundäre Prävention versucht, je nach zugrunde liegenden Prämissen, "nach" der Aufnahme des ersten Kontaktes mit psychoaktiven Substanzen, entweder den weiteren Gebrauch gänzlich zu verhindern oder Konsumformen zu fördern, die als weniger schädlich gelten (also im Sinne von harm reduction). Im Rahmen der tertiären Prävention spielen vor allem Entzugsbehandlungen und rückfallverhütende Maßnahmen eine Rolle. Es wird mithin deutlich, daß sich das allgemeine Präventionsverständnis, im Sinne einer generalisierten und unmittelbaren Schadensvorbeugung, vornehmlich an der Kategorie Primärprävention orientiert, während sekundäre und vor allem tertiäre Prävention, schon allein wegen ihrer Substanzspezifizität, eher interventionistischen Charakter haben.
Es stellt sich die Frage, welchen Sinn diese Aufteilung für die konkrete suchtpräventive Arbeit machen könnte. Erster Punkt ist die Aufteilung in substanzunspezifische und substanzspezifische Prävention. Substanzspezifische Prävention beschreibt dabei Maßnahmen, die sich unmittelbar auf den Umgang mit Drogen beziehen und demzufolge auch ihren möglichen Gebrauch direkt thematisieren. Substanzunspezifische Maßnahmen versuchen dagegen unter der gleichen Zielstellung, die Voraussetzungen für einen Konsumverzicht beziehungsweise ein bestimmtes Konsumverhalten, je nach zugrunde liegenden Prämissen, zu schaffen, ohne den Gebrauch von Drogen direkt zu thematisieren. Im primärpräventiven Bereich wird davon ausgegangen, daß substanzspezifische Maßnahmen, egal ob es sich dabei um abschreckend gedachte, neutrale oder positive Informationen handelt, entweder nicht adäquat verarbeitet werden können oder sogar die Neugier der Adressaten auf den Konsum psychoaktiver Substanzen steigern
 .
Dem entsprechend bleiben substanzspezifische Maßnahmen fast
ausschließlich dem sekundär- und tertiärpräventiven
Bereich vorbehalten.
.
Dem entsprechend bleiben substanzspezifische Maßnahmen fast
ausschließlich dem sekundär- und tertiärpräventiven
Bereich vorbehalten. Zweiter Punkt ist die Ermittlung von Risikogruppen beziehungsweise die Definition von Zielgruppen für unterschiedlich gestaltete präventive Maßnahmen. Während im Bereich der Primärprävention die Unterscheidung von Risikogruppen nach der Verdrängung des Risikofaktorenansatzes weitestgehend zugunsten einer generalpräventiven Ausrichtung aufgegeben wurde, wird sie vor allem in der sekundären Suchtprävention noch häufig angewendet. Die starke Diversifizierung von Lebensstilen in der Jugendkultur scheint Sucht- und Sozialisationsforscher geradezu dazu einzuladen, spezifische Maßnahmen für spezifizierte (jugendliche) Zielgruppen zu konstruieren, die in der Regel mit mehr oder minder pauschalisierten Verhaltenszuschreibungen einhergehen (beispielsweise die sogenannte "Rave-Kultur").
Dritter und letzter Punkt ist der Bezug der Unterteilung von primärer, sekundärer und tertiärer Prävention zum Grundgedanken des Abstinenzanspruches. Erst durch den Bezug zu diesem normativen Anspruch, der den Gebrauch illegalisierter psychoaktiver Substanzen pauschal mit dem Mißbrauch gleichsetzt und als abweichendes Verhalten markiert, macht es Sinn eine Grenzlinie zwischen "noch nicht Konsumierenden" und denen, die schon Erfahrungen mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen haben, zu ziehen. Orientiert an der absoluten Zielvorgabe Abstinenz, können Informationen zum funktionalen Gebrauch psychoaktiver Substanzen in der Kategorie sekundäre Prävention, im Sinne einer Schadensreduzierung, durchaus "zugelassen", gleichzeitig aber in der Kategorie primäre Prävention als Anstiftung zum Drogengebrauch pauschal abgelehnt werden. Der Probierkonsum von illegalisierten Drogen bedeutet dabei die Übertretung eines Verbotes, das die Grenzlinie zwischen (gesellschafts-)konformem und abweichendem Verhalten markiert und den Probierer von einem hilfs- und unterstützungswürdigen Heranwachsenden in einen delinquenten Jugendlichen verwandelt, der im besten Fall resozialisiert werden kann. Durch diese Sichtweise verlieren jugendliche Drogenprobierer im wahrsten Sinne des Wortes ihre Unschuld und werden so Teil einer marginalisierten Minderheit.
Letztendlich zielen präventive Maßnahmen, die das Selbstbestimmungs- und Selbstentfaltungsrecht des Individuums mißachten, auf die Konformisierung der Gesellschaft und die Unterdrückung kreativer Potentiale ab. "Prävention [gilt] somit als Bezeichnung jener gesellschaftlich organisierten Maßnahmen, die die Konformität der Gesellschaftsmitglieder mit Verhaltenserwartungen des sozialen Systems sichern und dementsprechend das Auftreten normabweichender Verhaltensweisen verhindern sollen"
 (Hervorhebungen nicht im Original, d.A.)
(Hervorhebungen nicht im Original, d.A.) -
Das Konzept Drogenmündigkeit
Wie oben aufgezeigt, unterliegt die gebräuchliche Begriffstrias Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention dem ideologischen Abstinenzgebot und stellt die möglichen Risiken des Drogengebrauchs in den Vordergrund. Sie ist daher als leitendes Paradigma einer akzeptanz- und ressourcenorientierten Drogenaufklärung ungeeignet – eine Einordnung des Drug-Checking-Modells in diesen Rahmen ist nicht sinnvoll. Drug-Checking ist vielmehr ein wesentlicher Aspekt im Konzept der Drogenmündigkeit, wobei Drogenmündigkeit selbstverständlich auch eine bewußte Entscheidung für Abstinenz mit einschließt.
"Unter Drogenmündigkeit soll individuelles und kollektives Handeln verstanden werden, durch welches Menschen in der Lage sind, unproblematische, das heißt integrierte, autonom kontrollierte und genußorientierte Drogenkonsumformen als in ihren eigenen (individuellen und kollektiven) Interessen liegend zu erkennen und zu entwickeln. Diese Herangehensweise fördert zugleich die Identifizierung von fördernden und hemmenden Bedingungen, unter denen die individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit in bezug auf autonom kontrollierte Drogenkonsumformen zeitstabil beeinflußt und kontrolliert werden kann."

Die wesentlichen Faktoren zur Förderung von Drogenmündigkeit bestehen im Erwerb beziehungsweise der Vermittlung von Handlungskompetenzen und dem ungehinderten Zugang zu allen Arten von Informationen über psychoaktive Substanzen. Gleichzeitig muß dem Individuum die Möglichkeit zu eigenverantwortlichen und autonom kontrollierten Entscheidungen gelassen werden, damit es in die Lage versetzt wird, mittels seines Handelns, seine individuellen und kollektiven Interessen zu erkennen und zu entwickeln. Ohne individuell geprägtes Erfahrungswissen ist mündiges Verhalten in keiner Hinsicht denkbar.
Drogenmündigkeit soll die Voraussetzungen dafür schaffen, daß die Formen des Drogenkonsums in den Lebensstilen der Menschen verankert werden und sowohl die allgemeinen sozialen Erwartungen als auch die selbst gestellten Anforderungen bewältigt werden können. Dazu gehört auch, daß eine von außen vorgenommene oder selbst gewählte Pathologisierung als bequeme Ausrede für Verhaltensmuster entfällt, die gegen die von außen gestellten sozialen Erwartungen und/oder die selbst gestellten Anforderungen gerichtet sind. In bezug auf mögliche Risiken soll die Drogenmündigkeit, unter dem Stichwort Handlungskompetenz, zu einem differenzierten Risikomanagement beitragen, indem der zweifellos hohe Wert Gesundheit mit konkurrierenden Zielen und Werten (z.B. Genuß, Bequemlichkeit, Lustgewinn) abgewogen wird.

Akzeptierende soziokulturelle Bezüge nehmen für Gebraucher illegalisierter Drogen einen wichtigen Stellenwert bei der Entwicklung von Handlungskompetenz ein. Sie begleiten das Individuum beim Erwerb von Erfahrungswissen und stellen in ihrer Funktion als soziale Stützsysteme im Rahmen eines differenzierten Risikomanagements eine unverzichtbare Ressource dar. Soziale Netzwerke drogenmündiger Individuen, die für ihre Mitglieder die vorhergehend beschriebenen Funktionen erfüllen, werden als Drogen-Kulturen bezeichnet.

"Die Tatsache, daß die meisten Menschen im Zusammenhang mit Alkohol Drogenmündigkeit erwerben, verweist jedoch darauf, daß sich diese Kompetenz in alltäglichen Sozialisationsbezügen außerhalb »institutionalisierter« Erziehung herausbilden und entwickeln kann."

Somit wird die Förderung dieser akzeptierenden soziokulturellen Bezüge zu einer wesentlichen Funktion einer auf Drogenmündigkeit ausgerichteten Drogenerziehung.
Eine wichtige Funktion von Drug-Checking als Maßnahme zur Förderung von Drogenmündigkeit besteht auch in einer allgemein präventiven Wirkung. Entsprechend der sprachlichen Herleitung des Begriffes Prävention (lat. praevenire = zuvorkommen), soll einer Schädigung – entsprechend der im Vorwort vorgestellten Argumente – zuvorgekommen und diese idealerweise gänzlich verhindert werden. Wichtig bleibt aber, daß der präventive Aspekt, unter Verzicht auf die Unterteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, nicht im Vordergrund steht, sondern die Förderung der Drogenmündigkeit allenfalls begleitet. Diese Sichtweise folgt der Überlegung, daß auch die Intentionen der Gebraucher von psychoaktiven Substanzen in der Regel auf die positiven Aspekte (z.B. Genuß, Entspannung, Lustgewinn) ausgerichtet sind, wozu die Vermeidung von unangenehmen Erlebnissen und jedweder Schädigung gleichsam automatisch dazugehört.
-
Risikokompetenz als Entwicklungsaufgabe
Für einen nicht geringen Teil der Heranwachsenden stellt der Wunsch nach Erfahrungen durch veränderte Bewußtseinszustände, auch durch den Einsatz illegalisierter Drogen, ein selbstverständliches Bedürfnis dar. Trotz aller Warnungen und Verbote stellt deshalb der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein weit verbreitetes Verhalten dar. Dies geschieht überwiegend ohne gravierende Selbst- und Fremdschädigungen, was bedeutet, daß die Mehrheit der Heranwachsenden die Qualifikation besitzt beziehungsweise erwirbt, mit möglichen Risiken des Drogengebrauchs kompetent umzugehen.
Die Begriffe Risikokompetenz und -management zielen auf die Erlangung und Förderung von Fähigkeiten im konkreten Umgang mit möglicherweise riskanten Situationen oder Verhaltensweisen ab. Wesentlicher Bezugspunkt ist deshalb das eigenverantwortlich handelnde Subjekt. Im Umgang mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen bedeutet Risikomanagement zum einen, die möglichen kurz- und/oder langfristigen Risiken des Drogengebrauchs einschätzen zu können und sie gegen die positiven Aspekte abzuwägen. In diesem Sinne ist die Bewertung und Einordnung von Informationen und Erfahrungen ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements. Die Möglichkeit illegalisierte Drogen vor dem Gebrauch im Rahmen eines Drug-Checking-Programms testen zu lassen, ermöglicht den Konsumenten, durch die genaue Kenntnis von Substanzqualität als auch von Substanzquantität und den sich daraus ergebenden zusätzlichen Reflexionsmöglichkeiten zu Set und Setting, sowohl die möglichen Risiken als auch die erwartbaren positiven Aspekte besser einschätzen zu können. Erst unter dieser Voraussetzung ist ein kompetenter und mündiger Umgang mit psychoaktiven Substanzen möglich. Damit stellt die Einbeziehung der Drug-Checking-Ergebnisse in die individuelle Gebrauchsentscheidung der Drogenkonsumenten einen gewichtigen Aspekt zur Vermeidung unerwünschter Fehl- oder Überdosierungen dar.
Der verantwortliche Umgang mit psychoaktiven Substanzen ermöglicht die Reflexion und auch den Erfahrungsaustausch mit anderen Drogengebrauchern innerhalb eines sozialen und kulturellen Netzwerkes. So kann durch die genaue Kenntnis über Quantität und Qualität der eingenommenen psychoaktiven Substanz(en) im Nachhinein häufig festgestellt werden, inwieweit mögliche Probleme im Zusammenhang mit dem Drogengebrauch von der eingenommenen Substanz oder aber von ungünstigen Set- und Setting-Faktoren abhängig sind. Die Erkenntnis, daß nicht allein die Substanz, sondern gleichrangig auch die eigene psychisch-emotionale Befindlichkeit sowie das soziale Umfeld zu einem positiven oder negativen Drogenerlebnis beitragen, stärkt die Handlungskompetenz des Drogengebrauchers.
Zu einem eigenverantwortlichen Risikomanagement gehört auch die Fähigkeit das Auftreten von Problemen frühzeitig zu realisieren und darauf angemessen zu reagieren. Dies umfaßt zum einen die Entwicklung eigener Lösungsansätze und zum anderen das Vermögen, Probleme artikulieren und Unterstützung von außen organisieren zu können.
-
Der präventive Aspekt von Drug-Checking
Die Gebraucher sogenannter Partydrogen bleiben in hohem Maße sozial integriert und konsumieren sozial unauffällig, nur wenige sind auf die Angebote klassischer Einrichtungen der professionellen Drogenhilfe angewiesen
 . Andererseits ist davon auszugehen, daß
die bisher weitestgehend fehlende Möglichkeit der Quantitäts-
und Qualitätskontrolle unreflektierte Konsumformen von synthetischen
Drogen bedingt und fördert
. Andererseits ist davon auszugehen, daß
die bisher weitestgehend fehlende Möglichkeit der Quantitäts-
und Qualitätskontrolle unreflektierte Konsumformen von synthetischen
Drogen bedingt und fördert  . Über die genaue Zusammensetzung
und mögliche Verunreinigungen der angebotenen und konsumierten
Substanzen ist in der Regel kaum etwas bekannt. Vor allem bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die sich für illegalisierte Drogen
interessieren, besteht ein hoher Bedarf an realistischen und nachvollziehbaren
Informationen. Der Bedarf entsprechender Beratungsangebote wird
bisher fast ausschließlich von szenenahen, respektive szeneinvolvierten
Projekten aufgegriffen, kann jedoch, aufgrund begrenzter Ressourcen,
nur teilweise gedeckt werden.
. Über die genaue Zusammensetzung
und mögliche Verunreinigungen der angebotenen und konsumierten
Substanzen ist in der Regel kaum etwas bekannt. Vor allem bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die sich für illegalisierte Drogen
interessieren, besteht ein hoher Bedarf an realistischen und nachvollziehbaren
Informationen. Der Bedarf entsprechender Beratungsangebote wird
bisher fast ausschließlich von szenenahen, respektive szeneinvolvierten
Projekten aufgegriffen, kann jedoch, aufgrund begrenzter Ressourcen,
nur teilweise gedeckt werden.Die durch das Drug-Checking verfügbaren Informationen (und die sich daraus ergebenden Lernmöglichkeiten) tragen dazu bei, die mit dem Gebrauch illegalisierter Drogen verbundenen Risiken besser einschätzen zu können. Insoweit erzielt Drug-Checking auch eine präventive Wirkung und ist wesentlicher Bestandteil eines neu ausgerichteten, an der Förderung von Drogenmündigkeit orientierten Präventionskonzeptes. Ein derartiges Präventionskonzept muß in eine Gesamtstrategie zur Förderung von Lebenskompetenz und Gesundheitsförderung eingebunden sein, denn "es geht darum, einen möglichst souveränen Umgang mit Drogen sowie das rechtzeitige Signalisieren von Hilfebedarf im Prozeß des ‚Lernens‘ von Drogenkonsum gesellschaftlich zu fördern und zu unterstützen"
 . Statt
der Vermittlung von Lebensstilvorgaben und moralisierenden Botschaften,
unter dem Verdikt eines normativen Abstinenzgebotes, stehen Strategien
zur Selbstbefähigung, die den persönlichen Voraussetzungen
sowie den individuellen und kollektiven Lebenslagen der Adressaten
Rechnung tragen, im Vordergrund.
. Statt
der Vermittlung von Lebensstilvorgaben und moralisierenden Botschaften,
unter dem Verdikt eines normativen Abstinenzgebotes, stehen Strategien
zur Selbstbefähigung, die den persönlichen Voraussetzungen
sowie den individuellen und kollektiven Lebenslagen der Adressaten
Rechnung tragen, im Vordergrund.Erst unter diesen Voraussetzungen wird Prävention als Risikobegleitung möglich, weil sie so ihre Unterstützungsangebote auch tatsächlich anbietet und nicht aufdrängt. "Dort aber, wo auf der Basis einer toleranten Grundhaltung eine Begleitung möglich ist, bietet sich auch die Chance, über Drogenkonsum, insbesondere die möglichen negativen Erfahrungen, in einer anderen Weise zu sprechen als zuvor. Die Tatsache, den Rauschmitteln nicht mehr einfach die Schuld für erlebte negative Erfahrungen zuschieben zu können, weil unter bestimmten Voraussetzungen der Genuß eben genußvoll sein kann, macht den Konsumenten deutlich, daß sie selbst an diesen Voraussetzungen auch teilhaben, das heißt Verantwortung tragen und nicht nur Spielball oder Opfer sind".

Zusammenfassend betrachtet bestehen die präventiven Zielsetzungen von Drug-Checking in:
-
Der Warnung vor möglichen oder sogar wahrscheinlichen Gesundheitsschädigungen, bedingt durch die Einnahme von Pillen, Pulvern und anderen Produkten mit psychoaktiven Inhaltsstoffen, die im wesentlichen nicht der vermeintlich erworbenen Substanz entsprechen oder außerordentlich hoch dosiert sind.
-
Der Vorbeugung von Gesundheitsschäden durch die Vermittlung von allgemeinen Informationen über Drogen und ihren Gebrauch sowie von protektiven Botschaften.
-
Einer Korrektur des Schwarzmarktes dahingehend, daß beim Erwerb von illegalisierten Drogen zum Eigenverbrauch möglichst weitestgehend gewährleistet ist, daß die erworbenen Produkte auch tatsächlich die erwarteten Substanzqualitäten und -quantitäten enthalten.
-
Der Förderung der Eigenkompetenz von Drogengebrauchern, denen durch die Vermittlung der Stoffanalyseresultate eine zusätzliche Möglichkeit zur Reflexion ihrer Konsumerfahrungen gegeben wird, insbesondere im Hinblick auf Set und Setting.
-
Der Förderung von autonomen sozialen Netzwerken, die nicht nur bei der Weitergabe und kritischen Reflexion von Informationen und Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen und damit der Entstehung von ernsthaften Problemen entgegenwirken können, sondern auch, in ihrer Funktion als soziale Stützsysteme, eine wichtige Ressource zur Bewältigung von problematischen Situationen bilden können.
-
Der bedarfsgerechten Darstellung von Informationen über das etablierte Drogenhilfesystems und der Beratung zu dessen professionellen Angebote.
Ein wichtiges Instrument zur Umsetzung dieser präventiven Zielsetzungen besteht in der Einrichtung und Durchführung eines flächendeckenden Monitoring-Systems. Durch einen langfristigen Erkenntnisgewinn sowohl über die jeweils gegenwärtige Situation als auch über Veränderungen am illegalisierten Drogenmarkt, besteht im Sinne eines Früherkennungssystems die Möglichkeit, mit Aufklärungs- und Beratungsangeboten sehr schnell auf neue Konsumtrends zu reagieren. Auch bei der Auswertung und Verwendung von Monitoring-Daten im Rahmen des Drug-Checking-Programms gilt immer, daß sich daraus entwickelte Maßnahmen am tatsächlich artikulierten Bedarf der Zielgruppe orientieren müssen. Werden hingegen die Monitoring-Daten mittels gezielter Suchfunktionen als Kontrollmechanismus für repressive Maßnahmen verwendet, ist damit ein massiver Vertrauensverlust der am Drug-Checking-Programm und der Datenerhebung beteiligten Organisationen vorprogrammiert.
-
-
Pädagogischer Effekt der veröffentlichten Testergebnisse
Durch die Veröffentlichung der Testergebnisse wird sowohl das Interesse für die Qualität der eingenommenen Drogen deutlich gesteigert als auch das allgemeine Interesse für die pharmakologische Wirkung der Substanzen. Das erste Studieren der "Pillen-Listen" ist oft der Einstieg in einen analytisch-wissenschaftlichen Lernprozeß im Umgang mit psychoaktiven Substanzen, welcher im Kreise der Nutznießer von alltagstranszendierenden Drogengebrauchsformen das erstrebte Ziel fördert, mehr Klarheit über sich, die Wechselwirkung der inneren und äußeren Welt und vor allem über das eigene bewußte Sein zu erlangen.

Beobachtungen bei Hunderten von Veranstaltungen, auf denen Eve & Rave präsent war
 , zeigten, daß in Gruppen von drogengebrauchenden Jugendlichen,
die in kleinen Gesprächsrunden die Testergebnisse, der "Pillen-Listen"
diskutierten, das Interesse für weitere Informationsmaterialien
weitaus größer war als dies bei allen anderen verfügbaren
Informationen der Fall gewesen ist. Viele Besucher, die sich an
den Eve & Rave Informationsständen nach neuen Materialien
umschauten, gaben auf Nachfrage an, daß ihr Bedürfnis
nach mehr Sachkunde zur Thematik durch die "Pillen-Listen"
geweckt worden sei.
, zeigten, daß in Gruppen von drogengebrauchenden Jugendlichen,
die in kleinen Gesprächsrunden die Testergebnisse, der "Pillen-Listen"
diskutierten, das Interesse für weitere Informationsmaterialien
weitaus größer war als dies bei allen anderen verfügbaren
Informationen der Fall gewesen ist. Viele Besucher, die sich an
den Eve & Rave Informationsständen nach neuen Materialien
umschauten, gaben auf Nachfrage an, daß ihr Bedürfnis
nach mehr Sachkunde zur Thematik durch die "Pillen-Listen"
geweckt worden sei.Die Veröffentlichung der Testresultate im Internet führt zur Erreichbarkeit einer völlig neuen Gruppe von Menschen mit Interesse an psychoaktiven Substanzen. Die große Mehrheit der Besucher der Internetseiten hatte zuvor keinen Kontakt mit einer Drogenberatungsstelle, das heißt, daß durch die Internetberatungsstelle eine Zielgruppe erreicht wird, die sich von den etablierten Beratungsangeboten der Drogenhilfe nicht angesprochen fühlte. Des weiteren ist ein stetig wachsender Informationsrückfluß bezüglich Erfahrungen und Problemen mit bestimmten Substanzen, respektive Substanzkombinationen zu verzeichnen. Somit kommt es durch diesen Internetservice zu einer Akkumulation von Know-how, das sowohl für Beratung als auch für Monitoring sinnvoll eingesetzt werden kann.

Konsumenten von Ecstasy, die durch zu häufigen Konsum nicht mehr die altgewohnte volle Wirkung spüren, können durch die "Pillen-Listen" oftmals schnell davon überzeugt werden, daß der Wirkungsabfall nicht auf "schlechte Ware" zurückzuführen, sondern durch die eigene Körperchemie bedingt ist. Die Einsicht, daß durch längere Konsumpausen der eigene Serotoninspiegel wieder aufgebaut werden muß, um den vollen Genuß bei einer erneuten Einnahme von Ecstasy wieder entfalten zu können, wird durch die "Pillen-Listen" gefördert. Die Veröffentlichung der Testresultate führt so direkt zu einer Minderung des Konsums. Diese Erkenntnis wurde auch bei der Überarbeitung der Party-Drogen-Broschüre von Eve & Rave berücksichtigt, indem deutlich der Zustand der Psyche und somit der Gehirnchemie (Set) als Indikator für die Qualität des Erlebnisses nach einer Pilleneinnahme hervorgehoben wird.

Im Gegensatz zu einem unreflektierten und destruktiven Drogenkonsum begünstigt Drug-Checking eine hedonistische und genußorientierte Verwendungsform von illegalisierten Drogen. Im englischen Sprachraum wird dies als recreational bezeichnet. Damit wird der Aspekt der Erholung und Entspannung des hedonistischen Drogengebrauchs betont. "Hedonistische oder rekreationale Funktionen werden überall dort angenommen, wo der Konsum um seiner selbst willen erfolgt, ohne daß Sucht vorliegt oder andere Zwecke als die Berauschung selbst intendiert sind. Ihre Beziehung zu den Kompensations- und Ventilfunktionen des Drogenkonsums sind ambivalent. Einerseits ermöglicht das genußvolle Erleben durch Drogen eine wirkungsvolle Kompensation der Widrigkeiten des Lebens, so daß Kompensationsfunktion und hedonistische Funktion untrennbar verbunden sind. Andererseits schließen sich Genuß und Sucht, wie sie durch die übermäßige Inanspruchnahme der Ventilfunktion des Drogenkonsums oft auftritt, gegenseitig aus. Während Sucht Kontrollverlust beinhaltet, wird Genuß durch Selbstkontrolle aufrechterhalten."

Gerade der Ecstasy-Konsum kann im Zusammenhang mit Techno durch den hedonistischen Ansatz eher erklärt werden als durch die Ventilfunktion von Drogen, also der Flucht aus bzw. vor dem Alltag. Als Voraussetzung der hedonistischen Funktion in Abgrenzung von der Ventilfunktion des Konsums psychoaktiver Substanzen nennt Blätter folgende Aspekte: "Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer hohen Genußqualität des Drogenkonsums und auch zur Reduzierung möglicher negativer Konsequenzen muß der Konsum mit Phasen der Abstinenz abgewechselt werden. Die notwendige Kontrolle fällt dabei um so schwerer, je intensiver der Drogengenuß erlebt wird, jedoch wird berichtet, daß selbst der Gebrauch der stark euphorisierenden Opiate durch die Einhaltung detaillierter, sozial vorgegebener Konsumrituale erfolgreich kontrolliert werden kann. Die hedonistischen, genußvollen Funktion des Drogengebrauchs können also langfristig besonders dort erlebt werden, wo eine enge Verbindung zu gruppenkohäsiven Funktionen und eine geeignete soziale Einbettung besteht."

Auch in den Niederlanden scheint die Erkenntnis, daß die Veröffentlichung der Testergebnisse vom präventiven Standpunkt aus nützlich ist, im Gesundheitsministerium Anlaß für eine Änderung der bisherigen Praxis zu geben, die bekanntlich keine regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse vorsieht. In einem Brief vom 1. Februar 1999 an den Vorsitzenden der 2. Kammer des niederländischen Parlaments schreibt die Ministerin für Volksgesundheit, Wohlfahrt und Sport, Frau E. Borst-Eilers, daß das Trimbos Institut den Auftrag erhält, die Struktur des DIMS neu zu gestalten, wobei unter anderem das Drug-Checking auf das notwendige Maß des Monitorings redimensioniert werden soll, die Präventionsbotschaften auf nationaler Ebene standardisiert und schriftlich herausgegeben werden sollen, wie auch die Testergebnisse des Drug-Checkings.

-
Zu vermittelnde Botschaften
Botschaften im präventiven Bereich müssen glaubwürdig sein, für die Empfänger unmittelbar nutzbares und nachvollziehbares Wissen transportieren, auf umfassenden Schutz der körperlichen, seelischen und sozialen Gesundheit ausgerichtet sein, zur Reflexion des eigenen und des Verhaltens anderer Menschen auch im Sinne eines fortschreitenden Risikobewußtseins anregen und der Eigenverantwortlichkeit der Empfänger Rechnung tragen. In diesem Sinne ergeben sich aus den oben formulierten Zielsetzungen folgende zu vermittelnde Kernbotschaften:
Trotz ihres gesetzlichen Verbots ist der Gebrauch von illegalisierten Drogen weder strafbar noch stellt er ein krankhaftes oder zwangsläufig in Abhängigkeit mündendes Verhalten dar.
-
Unkontrolliert hergestellte Substanzzubereitungen können unerwünschte Beimengungen und/oder Fehldosierungen enthalten, deren Existenz nur durch Drug-Checking vollständig nachgewiesen werden kann.
-
Wer Drogen konsumiert kann durch die Befolgung bestimmter Regeln ein mögliches Risiko beim Drogengebrauch reduzieren.
-
Der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen kann zu problematischen Konsummustern führen, die am effektivsten durch die Reflexion des eigenen Konsumverhaltens erkannt und verändert oder gänzlich vermieden werden können.
-
Durch den Erlebnis- und Erfahrungsaustausch mit Freunden und anderen Gleichgesinnten können beginnende Probleme eher erkannt und besser bewältigt werden.
-
Bei akuten oder manifesten Problemen ist es wichtig, nicht aus falscher Scham oder der Angst vor Stigmatisierung oder gar Kriminalisierung auf Hilfe von außen zu verzichten, die im eigenen sozialen Umfeld wie auch bei Szeneorganisationen oder weiterführend bei (Drogen-)Beratungsstellen gesucht werden kann.
-
-
Peers als Szenemultiplikatoren
-
Peer-group-Ansätze
Peer -group-Ansätze
 gehen in ihrer Wissenschaftlichkeit
einerseits auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse zurück,
die der Interaktion zwischen Gleichaltrigen/Gleichbetroffenen,
bezogen auf den gegenseitigen Lernvorgang einen hohen Stellenwert
einräumen. Zum anderen "[...]
verweisen auch sozialpädagogische Ansätze darauf,
daß zwischen den Mitgliedern einer Peer-group ein sozialer
und kultureller Zusammenhang besteht, der sich aus ähnlichen
gesellschaftlichen Lagen und Handlungsanforderungen ergibt und
im Sinne einer Alters- oder Gleichbetroffenenkultur soziale
Einbindung sowie informelle Hilfe- und Unterstützungsressourcen
bei der Bewältigung gleicher oder vergleichbarer lebensspezifischer
Probleme anbietet."
gehen in ihrer Wissenschaftlichkeit
einerseits auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse zurück,
die der Interaktion zwischen Gleichaltrigen/Gleichbetroffenen,
bezogen auf den gegenseitigen Lernvorgang einen hohen Stellenwert
einräumen. Zum anderen "[...]
verweisen auch sozialpädagogische Ansätze darauf,
daß zwischen den Mitgliedern einer Peer-group ein sozialer
und kultureller Zusammenhang besteht, der sich aus ähnlichen
gesellschaftlichen Lagen und Handlungsanforderungen ergibt und
im Sinne einer Alters- oder Gleichbetroffenenkultur soziale
Einbindung sowie informelle Hilfe- und Unterstützungsressourcen
bei der Bewältigung gleicher oder vergleichbarer lebensspezifischer
Probleme anbietet." 
Dieses Wissen sollte sich, so Barsch, professionelle Drogenhilfe zu nutzen machen, stehen doch Peer-groups in der Regel einer Vermittlung von Präventionsbotschaften, die glaubwürdig und authentisch sind und durch der Szene oder Subkultur angehörigen Personen vermittelt werden, offen gegenüber. Peer-group-Ansätze werden im folgenden Abschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen aufgegliedert, den Peer-involvement-Strategien einerseits, die eher von außen, also im Falle der Suchtprävention von der Drogenhilfe initiiert werden, und den Peer-support-Konzepten anderseits, die eher zum Ziel haben, bestehende Strukturen zu unterstützen und zu fördern.
-
Peer-involvement
Peer-involvement-Strategien finden sich vor allem in drei verschiedenen Ansätzen wieder
 .
.-
Peer-consulting versteht sich als Beratung von Gleichen durch Gleiche. Jugendliche haben in diesem Rahmen die Funktion in verschiedenen sozialen Bereichen als Berater aufzutreten.
-
Peer-education versteht sich als Erziehung durch Gleiche. Speziell ausgesuchte und geschulte Jugendliche arbeiten als Multiplikatoren für Gruppen, denen sie in Form von Informationsveranstaltungen Wissen vermitteln. Peer-education zielt darauf ab, über Normen, Werte und Verhalten zu reflektieren und diese, wenn nötig zu ändern.

-
Peer-projects verstehen sich als ein Tätigwerden von gleichaltrigen/gleichgesinnten Multiplikatoren für Gleichaltrige/Gleichgesinnte. Das geschieht zum Beispiel durch die Erstellung von Theaterstücken, Plakaten, Broschüren, Videos.
Diesen drei unterschiedlichen Peer-involvement-Strategien ist eines gemeinsam, sie sind von außen initiiert. Ihr Ziel ist es, einen besseren Zugang zur Zielgruppe zu erlangen, indem kommunikative Schranken durch die Peers überwunden werden sollen. Somit erlangt soziale Arbeit die Möglichkeit, die Lebenswelt der Adressaten mit Hilfe von Peers zu erschließen und kann über diese pädagogisierend einwirken
 . Die
Organisationsstruktur von Peer-involvement-Projekten beruht
auf rein hierarchischen Elementen: Präventionsexperten
übertragen ihre Vorstellung von Suchtprävention durch
Schulungen und Weiterbildungen auf die in vielen Fällen
explizit ausgesuchten Peers, die
dann in einem von oben abgesteckten Rahmen tätig werden
können, der jedoch den eigenen Gedanken und Veränderungswünschen
wenig Freiraum läßt.
. Die
Organisationsstruktur von Peer-involvement-Projekten beruht
auf rein hierarchischen Elementen: Präventionsexperten
übertragen ihre Vorstellung von Suchtprävention durch
Schulungen und Weiterbildungen auf die in vielen Fällen
explizit ausgesuchten Peers, die
dann in einem von oben abgesteckten Rahmen tätig werden
können, der jedoch den eigenen Gedanken und Veränderungswünschen
wenig Freiraum läßt. 
"In ihrem Grundsatz akzeptieren die Methoden des Peer-involvement nur insofern die Laienkompetenz und das Selbsthilfepotential der Peer-groups, als diese für den Prozeß der Transmission der durch Experten formulierten Inhalte geeignet sind."

Peer-support hingegen, und das wird im nächsten Punkt deutlich, setzt genau an diesem Kritikpunkt an und stellt mit einem ähnlichen Grundmodell eine völlig andere Herangehensweise in den Vordergrund.
-
-
Peer-support – ähnlich und doch anders
Peer-support arbeitet ebenso wie Peer-involvement mit der Interaktion unter Gleichaltrigen und Gleichbetroffenen. Dies geschieht jedoch nicht durch ein von außen initiiertes Projekt, indem die Peers lediglich als "Marionetten" in einem von Präventionsexperten hierarchisch geführten System fungieren. Peer-support hingegen versucht, die Selbsthilfepotentiale und die vorhandene Betroffenenkompetenz zu fördern und zu unterstützen. Zu konstatieren ist, daß Peer-support z.B. in der Drogenszene – unbeabsichtigt – tägliche Realität ist. "User kopieren – wie alle Menschen – ihre Umgebung, beurteilen und kritisieren das Verhalten anderer User in der Szene etc.. Peer-support ist daher kein neuer Ansatz, sondern lediglich die – bewußte – Zuhilfenahme dieser alltäglichen gegenseitigen Beeinflussung innerhalb einer Gruppe."

Mitglieder von Peer-groups werden im Rahmen dieses Konzeptes als autonome und selbstorganisierte Menschen gesehen. Soziale Arbeit sieht ihre Aufgabe nicht mehr darin, pädagogische Anleitungen zu geben, sondern, "[...] die Peers zu befähigen, die sozialen Ressourcen ihres Netzwerkes zu fördern, zu pflegen und diese in eigener Regie [...] zur Verminderung von Drogenproblemen zu handhaben."

Die Peers werden als kompetente Beteiligte aufgefaßt, deren Betroffenenkompetenz von den Präventionsexperten anerkannt wird. So verstanden können die Peers wesentlich freier und selbstbestimmter als im Falle des Peer-involvements tätig werden.
Soziale Arbeit beschränkt sich beim Peer-support auf das Stiften von Zusammenhängen, auf unterstützende Begleitung, auf Anregungen und Ermutigungen, Hilfe bei Sachverwaltung, anwaltschaftlicher Fürsprache und das Fördern von Netzwerkstrukturen. Dies beinhaltet ein neues Selbst- und Helferverständnis von Sozialpädagogen.
-
Notwendiger Einsatz von Szenemultiplikatoren
Professionelle Drogenhilfe hat große Schwierigkeiten, die Partydrogenszene zu erschließen. Kontakte mit Usern in den Einrichtungen der Drogenhilfe sind aufgrund hoher Zugangsschwellen und einem zu geringen Angebotsspektrum bezogen auf Partydrogen weitestgehend nicht vorhanden.
Jedes Mitglied einer drogengebrauchenden Gruppe, das Informationen über, respektive Erfahrungen mit Gebrauch von psychoaktiven Substanzen an andere Szenemitglieder weitergibt, erfüllt unabhängig von der jeweiligen Informations- und Erfahrungsquelle, die Funktion eines Szenemultiplikators.
Wie durch Forschungsergebnisse inzwischen hinreichend und genügend belegt ist, sind für die Gebraucher illegalisierter Substanzen ihre Freunde die Hauptinformationsquellen in Bezug auf Wirkungsweisen, Gebrauchsspezifika und mögliche Gefahren
 . Dabei spielt
nicht nur der leichtere Zugang zu den Informationen der Freunde
eine Rolle, sondern
auch deren hohe Glaubwürdigkeit
. Dabei spielt
nicht nur der leichtere Zugang zu den Informationen der Freunde
eine Rolle, sondern
auch deren hohe Glaubwürdigkeit  , welche aus der eigenen
Drogenerfahrung und maßgeblich aus der gemeinsamen Identität
innerhalb der Subkultur resultiert.
, welche aus der eigenen
Drogenerfahrung und maßgeblich aus der gemeinsamen Identität
innerhalb der Subkultur resultiert.Drogenaufklärungsarbeit, die von den Adressaten akzeptiert und als hilfreich empfunden wird, führt in den Szenen automatisch zu einer regen Kommunikation über die neu gewonnenen Erkenntnisse. Die daraus resultierende Informationsverarbeitung in der Gruppe fördert nicht nur den Wissenszuwachs, sondern auch die Herausbildung neuer sozialer Netze, die zudem als soziale Stützsysteme wirken.
Überträgt man diese Erkenntnisse auf den Partydrogenbereich, so kann als wichtigste Aufgabe hervorgehoben werden, die individuellen und kollektiven Kompetenzen der Szeneangehörigen zu fördern, die Entwicklung sozialer Netzwerke zu unterstützen und für besonders Interessierte die Möglichkeit zu schaffen, auch ein weitergehendes Interesse an Drogen- und Partyarbeit befriedigen zu können.
Herauszustellen sind, neben von außen initiierten Partyprojekten durch die professionelle Drogenhilfe, wie z.B. dem ecstasy-project in Hamburg (Büro für Suchtprävention) und des Partyprojektes in Bremen, die selbstorganisierten Fortbildungs- und Unterstützungsangebote aus der Szene selbst. Ergebnis dieser Bemühungen sind viele in verschiedenen Städten neugegründete und nun aktiv wirkende selbstorganisierte Gruppen, aus deren Bemühen heraus vermutlich weitere Gruppen hervorgehen werden. Insbesondere nach der Gründung des Vereins Eve & Rave Berlin im Oktober 1994 wurden innerhalb Deutschlands, insbesondere mittels Unterstützung regionaler AIDS-Hilfen, weitere Vereine gegründet.
Beispielhaft in diesem Bereich sind die Eve & Rave Vereine, die stetig bemüht sind, im Sinne des peer-support und des self-empowerments neue Aktivisten, vor allem aus der Partyszene, zur Mitarbeit zu ermutigen und ihnen differenzierte Schulungsangebote anzubieten.
Seminar- und Schulungsangebote, die ein differenziertes und der Erfahrungswelt von drogengebrauchenden Menschen angemessenes (Drogen-) Wissen vermitteln, sind als flankierende Maßnahmen für ein Drug-Checking-Programm zu verstehen, dessen Ziel es letztendlich ist, über den Weg eines informierten und somit risikoärmeren Umgangs mit Drogen, Drogenmündigkeit zu fördern.
-
-
Die Rolle von etablierten Drogenberatungsstellen in der Partydrogenarbeit
-
Grundstruktur des etablierten Drogenhilfesystems
Die in diesem Abschnitt dargestellten Ausführungen behandeln schwerpunktmäßig das Drug-Checking-Modell aus der Sichtweise der etablierten, das heißt staatlich anerkannten und subventionierten, Drogenhilfeeinrichtung. Grundsätzlich unterliegt die etablierte Drogenhilfe den Vorgaben des Strafrechts. Ihre Arbeit ist größtenteils den gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Folgen der Prohibition geschuldet. Seitdem innerhalb des BtMG Strafe und Therapie miteinander verquickt wurden, kann eine klassische "Suchtarbeit" selbst im therapeutischen Setting einer abgeschiedenen Therapiestätte nicht mehr stattfinden
 . So ist die Rolle des Helfers und seiner Beziehung
zum Klienten maßgeblich durch das Strafrecht bestimmt.
"Die Auseinandersetzung mit der Strafverfolgung und
deren Verhinderung tritt in den Vordergrund. Taktisch-prophylaktisches
Vorgehen der KlientInnen und gerichtliche Auflagen greifen ineinander
und definieren die Rolle der BeraterIn um: Von der BeraterIn
für Drogen- und Lebensfragen zur StrafvermeidungshelferIn.
Die gemeinsame Erarbeitung von Alternativen zum Drogengebrauch,
die Bearbeitung psychosozialer Ursachen, die
Begleitung der KlientInnen auf der Grundlage von Kontinuität,
Klarheit und Eindeutigkeit wird erschwert und durch Abbruch,
Inhaftierung, Justizdruck häufig verunmöglicht."
. So ist die Rolle des Helfers und seiner Beziehung
zum Klienten maßgeblich durch das Strafrecht bestimmt.
"Die Auseinandersetzung mit der Strafverfolgung und
deren Verhinderung tritt in den Vordergrund. Taktisch-prophylaktisches
Vorgehen der KlientInnen und gerichtliche Auflagen greifen ineinander
und definieren die Rolle der BeraterIn um: Von der BeraterIn
für Drogen- und Lebensfragen zur StrafvermeidungshelferIn.
Die gemeinsame Erarbeitung von Alternativen zum Drogengebrauch,
die Bearbeitung psychosozialer Ursachen, die
Begleitung der KlientInnen auf der Grundlage von Kontinuität,
Klarheit und Eindeutigkeit wird erschwert und durch Abbruch,
Inhaftierung, Justizdruck häufig verunmöglicht." 
Bausteine des derzeitigen etablierten Drogenhilfesystems sind sogenannte suchtpräventive Angebote, zielgruppenspezifische Arbeitsansätze (z.B. Jugendliche, Frauen, Migranten), Kontaktstellen (inklusive Streetwork), Beratungseinrichtungen, Krisendienste, ambulante und stationäre Therapien, Überlebenshilfen, psychosoziale Begleitung der Substitution, betreute Wohnplätze, Tagesstätten, Beschäftigung und berufliche Rehabilitation.
Diskutiert, geplant oder auch teilweise schon durchgeführt werden weitere Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Konsumräumen, Heroinvergabe, Safer-Use-Training und Drug-Checking. Allerdings beziehen sich die derzeitigen unmittelbar klientenbezogenen Leistungen fast ausschließlich auf Menschen mit chronischen Opiatkonsummustern beziehungsweise damit einhergehenden polyvalenten Konsummustern.
Vor dem Hintergrund illegalisierter Zugänge zu den konsumierten Substanzen und eines chronischen Dauerkonsums tritt die vom etablierten Drogenhilfesystem angesprochene und zu betreuende Konsumentengruppe in der Regel mit einem ganzen Bündel klar benennbarer Problemstellungen physischer, psychischer, sozialer und justitieller Art auf.
Grundsätzlich sind die angebotenen Hilfen auf die Zielsetzung einer abstinenten Lebensweise abgestimmt, konsumbezogene Hilfen gelten weitgehend als nachrangig und unterliegen einer sogenannten ultima ratio Regelung. In jüngster Vergangenheit setzt allerdings in Teilbereichen der Drogenhilfe ein neuer Trend zur Beschäftigung mit Konsumentengruppen ein, die im Regelfall keine Opiate konsumieren, sondern erlebnisorientiert zum Beispiel mit Partydrogen experimentieren. Dies gilt vor allem für Beratungseinrichtungen, Krisendienste und Projekte der Sekundärprävention mit Schnittstellen zur Jugendarbeit. Allerdings ergeben sich in diesem neuen Tätigkeitsbereich mehrere Problemstellungen:
-
Die Drogenhilfe ist von ihrem herkömmlichen abstinenzorientierten Arbeitsansatz her auf die Problemeinsicht (vielfach auch Krankheitseinsicht genannt) ihrer Klienten fixiert und favorisiert, auch im Bereich der Partydrogen, generalisierend den Konsum vermeidende Interventionen und auf absoluten Konsumverzicht ausgerichtete Beratungsstrategien.
-
Dieser Arbeitsansatz entspricht häufig nicht den äußerst differenzierten und oftmals auch von weiterer Konsumbereitschaft unterlegten Fragestellungen der Konsumenten bezüglich Substanz- und Mischwirkungen, Verhaltensregeln, Einstellungsmustern, zu bevorzugenden Sets und Settings, und so weiter.
-
Umgekehrt werden aus der Sicht von Partydrogenkonsumenten die Leistungen von Einrichtungen der Drogenhilfe als moralisierend, generalisierend und problemfixiert erlebt.
-
-
Drug-Checking – Einbezug der etablierten Drogenhilfe
Trotz all dieser Einwendungen wird die Einbindung von Teilen der etablierten Drogenhilfe in ein risikominimierendes Drug-Checking aus mehreren Gründen dennoch als sinnvoll beziehungsweise notwendig eingeschätzt:
-
Davon ausgehend, daß die kommunikativen Strukturen von Partydrogenszenen wiederum nur für einen Teil der Konsumenten zugänglich sind, ist eine im Trend ansteigende Anzahl von Konsumenten zu erwarten, an denen szenespezifisch formulierte und in klassische Szenestrukturen eingespeiste Informationen vorübergehen. Darüber hinaus erreichen Drogenhilfeeinrichtungen mit jugendspezifischen Ansätzen Kreise möglicher Konsumenten, die (auf Grund ihres familiären, sozialen, kulturellen oder ethnischen Backgrounds) zumindest in der Frühphase des Konsums nicht oder nur selten auf spezifischen Events der Partyszenen anzutreffen sind. Für diese Gruppen könnte ein Drug-Checking-Ergebnisse einbeziehendes Beratungsangebot in etablierten Drogenhilfeeinrichtungen attraktiv und sinnvoll sein.
-
Gerade für Eltern und Angehörige von Konsumenten, aber auch für Mitarbeiter in pädagogischen Arbeitsfeldern (Jugendeinrichtungen, Schulen) stellt die etablierte Drogenhilfe eine rege nachgefragte Informations- und Klärungsinstanz dar. Eine auf der Grundlage gesicherter Substanzerkenntnisse durchgeführte Drogenberatung wäre ein wichtiger Beitrag, die Fähigkeit von Eltern und Pädagogen zu fördern, sach- und beziehungsgerechte Handlungsstrategien zu entwickeln und den produktiven Kontakt zu den ihnen nahestehenden beziehungsweise "anvertrauten" jungen Konsumenten aufrecht zu erhalten.
-
In Teilbereichen des Partydrogenkonsums sind immer wieder Übergänge zu chronischen Konsummustern (Abhängigkeiten) zu beobachten und damit ein relativ klar definierter Beratungsbedarf beziehungsweise therapeutischer Behandlungsbedarf. Für Menschen mit drogenassoziierten und mehrere Lebensbereiche einbeziehenden Problemstellungen ist der Einbezug in einen Kontext der umfassenden Problemklärung und eventuell der Weitervermittlung in geeignete Einrichtungen der Drogen- therapie sinnvoll.
-
Der etablierte Drogenhilfebereich ist in seinem Arbeitsauftrag auf die Nutzung von außerhalb des eigenen Systems liegenden Angebotsstrukturen angewiesen. Beispielhaft seien hier die allgemeinmedizinischen und die allgemeinpsychiatrischen Leistungen genannt. Auch die Angebote der Selbstorganisationen und Selbsthilfe, der Straffälligenhilfe, der Wohnungslosenhilfe wie auch der Jugendhilfe gehören in diesen Bereich. Des weiteren müssen hier auch die Arbeits- und Berufsförderung erwähnt werden. Diese weit verzweigten systemischen Gegebenheiten und das damit verbundene Erfahrungswissen sollten in geeigneter Form auch für Konsumenten von Partydrogen nutzbar gemacht werden.
-
Im etablierten Drogenhilfebereich stehen personelle, räumliche, technische und materielle Ressourcen zur Verfügung. Auch diese sind – wiederum in geeigneter Form – zur Plazierung und Durchführung risikomindernder Strategien nutzbar zu machen. Denkbar sind zielgruppenspezifische Krisentelefone, spezielle Beratungsangebote in Kooperation mit Selbsthilfegruppen, Trainings zur Risikominderung, etc.
-
Die Einbindung tradierter Systemteile der Drogenhilfe könnte zudem einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Ausdifferenzierung der Angebotsstruktur der Drogenhilfe und damit zur Effektivierung sogenannter sekundärpräventiver Bemühungen leisten.
Eine generelle Inanspruchnahme der etablierten Drogenhilfe für das Drug-Checking scheint allerdings wenig sinnvoll zu sein. Voraussetzungen sind:
-
Kooperationsbereitschaft mit Selbsthilfegruppen und Szeneorganisationen
-
Zeitlich und/oder räumlich getrennte Unterstützungsangebote für "traditionelle" Konsumenten und Partydrogenkonsumenten
-
Qualifiziertes Personal im Bereich Partydrogen, Jugendhilfe
-
aktive Mitgestaltung an Strategien der Risikominderung.
-
_________________________
Hinwendung zur Subsidiarität im Drogenbereich durch konsequentes Durchsetzen
des Prinzips "Selbstbefähigung/-organisation vor Fremdbestimmung und Fremdhilfe"Ideologische oder moralische Überzeugung darf nicht länger über das Gewähren von Hilfen entscheiden, darf nicht länger im Rahmen von Drogenhilfe das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen durch eine umarmende "fürsorgliche Belagerung" ersticken. Eine auf die Unverletzlichkeit ihrer Mitglieder bedachte Gesellschaft muß statt dessen ein innovatives Hilfesystem entwickeln, das Selbstbefähigung und -organisation der Hilfesuchenden in den Vordergrund stellt. Dies hat seinen Niederschlag nicht nur in der Schaffung von Rahmenbedingungen für die Befähigung des einzelnen zu einem autonom kontrollierten, genußorientierten und souveränen Umgang mit Drogen zu finden. Dieses Prinzip muß sich auch in der konkreten Ausgestaltung von Hilfe- und Behandlungsangeboten wiederfinden, die "self-empowerment" des einzelnen, der "communities" und entsprechender Betroffenengruppen in das Zentrum ihres Wirkens zu stellen haben. In diesem Sinne sind auch indirekt vermittelte Botschaften eines Gebots – beispielsweise unter dem Motto "safe" – durch Botschaften zum Risikomanagement – beispielsweise mit dem Verweis auf "safer" – zu ersetzen.
Die Drogenpolitik braucht eine neue Logik
Memorandum zu einem drogenpolitischen Neubeginn
akzept-Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik;
Bundesverband der Eltern und Angehörigen für humane und akzeptierende Drogenarbeit;
Bundesweites JES-Netzwerk; Deutsche AIDS-Hilfe;
Deutsche Gesellschaft für Drogen- und Suchtmedizin
Eve & Rave, Vereine zur Förderung der Partykultur und Minderung der Drogenproblematik; Berlin 1998, S. 9 -
-
Die Rolle von Szeneorganisationen in der Partydrogenarbeit
-
Grundlage der Arbeit von Szeneorganisationen
Mitarbeiter von Szeneorganisationen bewegen sich zumeist schon in Szenezusammenhängen, bevor sie anfangen, sich in einem Projekt zu engagieren und haben darüber hinaus häufig eigene Erfahrungen mit dem Gebrauch psychoaktiver Substanzen. Aus dem Bedürfnis heraus, im Rahmen von Parties zu kommunizieren, und dem Wunsch, nette Leute zu treffen und zusammen gut drauf zu sein, entsteht der Gedanke, mehr Verantwortung zu übernehmen und an der Schaffung einer informellen und selbst organisierten sozialen Infrastruktur innerhalb der Partyszene mitzuwirken. Gleichermaßen steht aber auch im Vordergrund, die eigene Kreativität auszuleben, die Lebensfreude zu steigern und mittels Rausch und Ekstase das eigene Bewußtsein zu erweitern
 .
Durch ihre Vertrautheit mit den Regeln und Ritualen der Partykultur
bringen
die Mitarbeiter von Szeneorganisationen in der Regel ein hohes
Maß an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in ihre Arbeit
ein.
.
Durch ihre Vertrautheit mit den Regeln und Ritualen der Partykultur
bringen
die Mitarbeiter von Szeneorganisationen in der Regel ein hohes
Maß an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in ihre Arbeit
ein. 
Wichtigste Voraussetzungen für den Zugang zur Partyszene sind eine nicht bevormundende Grundhaltung, eine vorbehaltlose Offenheit für die Belange der Zielgruppe und eine außerordentlich hohe Relevanz der angebotenen Informationen. Neben der starken Glaubwürdigkeit besteht der Vorteil von Szeneorganisationen gegenüber der klassischen Drogenhilfe vor allem auch darin, daß sie dort präsent sind, wo tatsächlich Drogen gebraucht werden – auf Open-Air-Raves, in Clubs und auf Parties – und daß sie in diesem Rahmen nicht als störende Fremdkörper wahrgenommen werden.
Die Arbeit vor Ort der meisten Szenenorganisationen ist stark personalkommunikativ und partizipativ angelegt. Ziel ist es, sowohl selbst den Dialog mit dem Partypublikum zu suchen als auch die Kommunikation innerhalb der Szene, nicht nur unmittelbar zum Thema Drogen, zu fördern. Der Grundgedanke basiert in der Anregung zur Herausbildung einer autonomen "Drogengebrauchskultur"
 als Teil einer erweiterten Party- und Lebenskultur. Innerhalb
derselben können Rituale und Regeln entwickelt werden,
die einen
genußorientierten und schadensminimierten Drogengebrauch
ermöglichen
als Teil einer erweiterten Party- und Lebenskultur. Innerhalb
derselben können Rituale und Regeln entwickelt werden,
die einen
genußorientierten und schadensminimierten Drogengebrauch
ermöglichen  . Ein grundlegendes Element dieser Art von
"Drogenkultur" besteht dabei in der Einbindung des
einzelnen Gebrauchers in ein soziales Netzwerk, das
nicht nur die Funktion eines Informationsforums erfüllt,
sondern im Bedarfsfall auch als Stützsystem wirkt.
. Ein grundlegendes Element dieser Art von
"Drogenkultur" besteht dabei in der Einbindung des
einzelnen Gebrauchers in ein soziales Netzwerk, das
nicht nur die Funktion eines Informationsforums erfüllt,
sondern im Bedarfsfall auch als Stützsystem wirkt. 
-
Voraussetzungen für die Vermittlung von Drug-Checking-Ergebnissen
Durch ihre gute Szeneeinbindung sind Szeneorganisationen dazu prädestiniert, im gegebenen Fall als Schnittstellen zwischen den Angeboten der professionellen Drogenberatungsstellen und der Nachfrage, respektive den Interessen einer drogengebrauchenden Szene zu wirken. Überall dort, wo Drogen und ihr Gebrauch direkt und personalkommunikativ thematisiert werden, haben sie in der Regel einen besseren Zugang zu aktuellen, ehemaligen und zukünftigen Drogengebraucher als die Mitarbeiter von professionellen Drogenberatungsstellen.
Im Rahmen der Durchführung von Drug-Checking besteht eine sehr wichtige Aufgabe von szenenahen Organisationen darin, im persönlichen Gespräch die Bedeutung von Set und Setting
 für die komplexen Wirkungen psychoaktiver Substanzen
in den Vordergrund zu rücken und damit der zu kurz greifenden
Auffassung entgegenzuwirken, daß die bloße Kenntnis
über Qualität und Quantität der konsumierten
Substanz als alleiniger Garant für eine angenehme und risikoarme
Drogenerfahrung gesehen werden kann. Der Harvard Professor für
Psychologie, Timothy Leary, entwickelte in den frühen 60er
Jahren die heute weltweit anerkannte Theorie von Dosis,
Set und Setting. Er folgerte aus vielen Beobachtungen,
daß
die Qualität einer Drogenerfahrung wesentlich durch die
verabreichte Menge (Dosis), durch die innere Bereitschaft
(Set) und die äußeren Umstände (Setting)
bestimmt werden
für die komplexen Wirkungen psychoaktiver Substanzen
in den Vordergrund zu rücken und damit der zu kurz greifenden
Auffassung entgegenzuwirken, daß die bloße Kenntnis
über Qualität und Quantität der konsumierten
Substanz als alleiniger Garant für eine angenehme und risikoarme
Drogenerfahrung gesehen werden kann. Der Harvard Professor für
Psychologie, Timothy Leary, entwickelte in den frühen 60er
Jahren die heute weltweit anerkannte Theorie von Dosis,
Set und Setting. Er folgerte aus vielen Beobachtungen,
daß
die Qualität einer Drogenerfahrung wesentlich durch die
verabreichte Menge (Dosis), durch die innere Bereitschaft
(Set) und die äußeren Umstände (Setting)
bestimmt werden  . Erst die Einsicht in die wesentliche Bedeutung
von Set und Setting, die unmittelbar Bezug nimmt auf die Erfahrungswelt
der (potentiellen) Drogengebraucher, ermöglicht auch die
Einsicht in die komplexen Möglichkeiten und Gefahren, die
mit dem Gebrauch von psychoaktiven Substanzen verbunden sind.
. Erst die Einsicht in die wesentliche Bedeutung
von Set und Setting, die unmittelbar Bezug nimmt auf die Erfahrungswelt
der (potentiellen) Drogengebraucher, ermöglicht auch die
Einsicht in die komplexen Möglichkeiten und Gefahren, die
mit dem Gebrauch von psychoaktiven Substanzen verbunden sind.Die personalkommunikativen Angebote von Szeneorganisationen, egal ob in der mobilen Arbeit in Clubs oder auf Parties vor Ort, am Beratungstelephon oder im Internet, bieten Menschen, die aktuell Drogen gebrauchen, die Möglichkeit, von dem Fach- und vor allem auch dem Erfahrungswissen der Ansprechpartner dieser Organisationen zu profitieren und bewußte, abgewogene Entscheidungen über ihr zukünftiges Konsumverhalten zu treffen. Die Kommunikationsangebote der Szeneorganisationen werden bewußt so gehalten, daß interessierten Außenstehenden keine Gespräche aufgedrängt werden. Ziel ist die Schaffung einer allgemein offenen und angenehmen Atmosphäre, in der jeder selbst entscheiden kann, wann, wie und mit wem er kommunizieren möchte. Auf diese Art und Weise wird ein Beitrag geleistet zur Bildung und Entfaltung sozialer Netzwerke.
Durch diese Aktivitäten der Szeneorganisationen werden Menschen neu zusammengeführt, Anregungen für das öffentliche wie auch private kulturelle Leben gegeben und Informationen zu Drogen angeboten. Des weiteren sind sie zur Stelle, wenn der Unterstützungsbedarf von Partybesuchern nicht mehr von ihrem eigenen Umfeld gedeckt werden kann, zum Beispiel in der akuten Krisenintervention.
Sowohl bei der Entgegennahme von Drogenproben für die Analyse im Labor, wie auch bei der Übermittlung der Testergebnisse an die Konsumenten, profitieren die Szeneorganisationen von ihrer hohen Glaubwürdigkeit bei den Partybesuchern. Dies zeigt sich zum Beispiel am regen Informationsfluß, der bereits bei der Abgabe der Proben zwischen den Konsumenten und den Mitarbeitern der Szeneorganisation zu beobachten ist. Aus den vielen Einzelinformationen, die zahlreiche Konsumenten den Mitarbeitern der Szeneorganisationen anvertrauen, entsteht ein recht präzises und klares Bild von der Situation in der entsprechenden Szene. Das heißt, durch die kontinuierlichen und zum Teil sehr vertraulichen Interaktionen im Rahmen des Drug-Checking-Programms, bilden sich die Mitarbeiter stetig weiter, so daß sie auf individueller als auch auf allgemeiner Ebene bezüglich der sozialen, kulturellen und transzendenten Ambitionen und den damit verbundenen Frage- oder Problemstellungen innerhalb der jeweiligen Szene recht gut im Bilde sind. Dies begünstigt in unverhofft und unerwartet auftretenden schwierigen Situationen eine adäquate Reaktion.
_________________________
Prohibition = Subvention
der organisierten KriminalitätDeutsches Sprichwort
-
Fussnoten:
-
G. Caplan: An Approach to Community Mental Health, London, 1961.

-
E. Pott: Zur Entwicklung der Sucht- und Drogenprävention, in: DHS (Hg.): Suchtprävention, Freiburg 1994, S.40.

-
K. Böllert: Prävention, in: D. Kreft und I. Mielenz: Wörterbuch der Sozialen Arbeit, Weinheim und Basel 1996, 4. Auflage, S. 440.

-
G. Barsch: Kritik und Alternativen zu aktuellen Präventionsmodellen, in: BOA e.V. (Hg.): Pro Jugend - Mit Drogen? »Mein Glück gehört mir!«, a.a.O., S.31.

-
H. Schmidt-Semisch: Überlegungen zu einem legalen Zugang zu Heroin für alle, in: Kriminologisches Journal, Jg. 22 Heft 2/1990, S. 122 - 139.

-
G. Barsch: Kritik und Alternativen zu aktuellen Präventionsmodellen, in: BOA e.V. (Hg.): Pro Jugend – Mir Drogen? »Mein Glück gehört mir!«, a.a.O., S. 38; Vgl.: H. Schmidt-Semisch: Zwischen Sucht und Genuß – Notizen zur Drogenerziehung, in: J.Neumeyer, G.Schaich-Walch: Zwischen Legalisierung und Normalisierung, Berlin 1992, S. 140 ff.

-
G. Rakete, U. Flüssmeier, L. Fischbach: Die Ecstasy-Hotline. Dokumentation, Hamburg 1997, S.6.

-
T.Harrach, J.Kunkel: Eve & Rave – Eine innovatives Raver-Projekt zur Drogenprävention in der Technoszene, in: J.Neumeyer, H.Schmidt-Semisch: Ecstasy – Design für die Seele, a.a.O., S. 298.

-
Akzept – Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, Bundesverband der Eltern und Angehörigen für humane und akzeptierende Drogenarbeit, Bundesweites JES-Netzwerk, Deutsche AIDS-Hilfe, Deutsche Gesellschaft für Drogen- und Suchtmedizin, Eve & Rave, Verein zur Förderung der Partykultur und Minderung der Drogenproblematik (Hg.): Die Drogenpolitik in Deutschland braucht eine neue Logik. Memorandum zu einem drogenpolitischen Neubeginn, Berlin 1998, S.7.

-
G. Nöcker: Richtungswechsel – Über die Notwendigkeit einer inhaltlichen Neuorientierung der Suchtprävention, in: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (Hg.): Prävention zwischen Genuß und Sucht, Düsseldorf 1991, S. 169.

-
H. Cousto: Drug-Checking in der Schweiz, in: R. Liggenstorfer et. al.: Die berauschte Schweiz, Solothurn 1998, S. 127.

-
H. Cousto: Eve & Rave. Vereinskonzept und Tätigkeitsbericht Berlin, Kassel, Köln, Münster, Schweiz, Solothurn März 1999, S. 43, 53, 61. (Zahlen der Informationsveranstaltungen der einzelnen Eve & Rave Vereine bis Ende 1998: Berlin: 288; Kassel: 47; Köln und Münster: 69; Zahl der Fortbildungskurse der MitarbeiterInnen der einzelnen Vereine bis Ende 1998: Berlin: 19, Kassel 4, Köln und Münster: 8, hinzu kommt die Zahl der Beteiligung, respektive Organisation von Tagungen, Kongressen und Seminaren: Berlin: 70, Kassel 57, Köln und Münster: 13).

-
In der Mail-Box von Eve & Rave Schweiz kommen mehr Fachinformationen von teilweise sehr erfahrenen Drogengebrauchern zur Thematik der Drogengkultur an, als Informationen abgefragt werden.

-
Eve & Rave Berlin e.V.(Hg.), H. Ahrens, K. Fischer, T. Harrach, J. Kunkel: Partydrogen’97. safer-use zu: ecstasy, speed, kokain, lsd und zauberpilzen, Berlin 1997, S.10.

-
A. Blätter: Kulturelle Ausprägungen und die Funktion des Drogengebrauchs. Ein ethnologischer Beitrag zur Drogenforschung, Hamburg 1990, S. 177.

-
E. Borst-Eilers: Stellungnahme der niederländischen Gesundheitsministerin zu Fragen der Neurotoxizizät von XTC, in: BINAD Nr. 14, Münster 1999, S. 23.

-
Peers sind bezogen auf ein soziales System gleichrangige Personen, die einen gemeinsamen lebensweltlichen Bezug besitzen.

-
G. Barsch: Drogenkonsum und Drogenpolitik in modernen Gesellschaften. Modernisierungserfordernisse und -chancen, dargestellt an Transformationsprozessen in Ostdeutschland, unveröffentlichte Habilitationsarbeit an der Technischen Universität zu Berlin, Fachbereich Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften, Berlin 1996, S.61f.

-
Vgl.: J. Künzel; Ch. Kröger; G. Bühringer: Evaluation des Präventionsprojekts MIND ZONE; in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Prävention des Ecstasykonsums – Empirische Forschungsergebnisse und Leitlinien; Dokumentation eines Statusseminars der BZgA vom 15. bis 17. September 1997 in Bad Honnef, Köln 1998, S. 152.

-
Personen, die nach den Peer-involvement-Strategien arbeiten, können als "undercover" Agenten bezeichnet werden. "Indem ihnen differenzierte technische Handlungsmethoden vermittelt werden, bleibt die Arbeit der jugendlichen Multiplikatoren von außen kontrollierbar und hält den Präventionsexperten Optionen der Steuerung und Regulierung offen." Zit. nach: G. Barsch: Drogenkonsum und Drogenpolitik in modernen Gesellschaften (...), a.a.O., S. 64; Vgl.: M. Galuske, W. Thole: Raus aus den Amststuben. Niedrigschwellige, aufsuchende und akzeptierende sozialpädagogische Handlungsansätze – Methoden mit Zukunft?, in: W. Hornstein, C. Luders: Zeitschrift für Pädagogik, Sonderheft Sozialpädagogik, Weinheim 8/1998.

-
Vgl.: J. Künzel; Ch. Kröger; G. Bühringer: Evaluation des Präventionsprojekts MIND ZONE; in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Prävention des Ecstasykonsums – Empirische Forschungsergebnisse und Leitlinien; Dokumentation eines Statusseminars der BZgA vom 15. Bis 17. September 1997 in Bad Honnef, a.a.O., S. 148 ff.

-
G. Barsch: Drogenkonsum und Drogenpolitik in modernen Gesellschaften (...), a.a.O., S.63.

-
F. Trautmann, C. Barendregt: Europäisches Peer-support Handbuch. NIAD (Hg.), Utrecht 1994, S.6.

-
G. Barsch: Drogenkonsum und Drogenpolitik in modernen Gesellschaften, a.a.O., S.66.

-
A Schroers, W. Schneider: Drogengebrauch und Prävention im Partysetting. Eine sozial-ökologische Evaluationsstudie. Forschungsbericht, Berlin 1998, S. 138, 163f.

-
L. Böllinger, H. Stöver, L. Fietzeck: Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik. Leitfaden für Drogenbenutzer, Eltern, Drogenberater, Ärzte und Juristen, Frankfurt am Main 1995, S.49.

-
W. Görgen: Auswirkungen der Drogengesetzgebung auf die ambulante und stationäre Beratung und Behandlung Drogenabhängiger, in: DHS (Hg.): Drogenhilfe und Drogenpolitik, Freiburg 1991, S. 50 ff., zit. nach: L. Böllinger, H. Stöver, L. Fietzeck: Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik. Leitfaden für Drogenbenutzer, Eltern, Drogenberater, Ärzte und Juristen, a.a.O., S.50.

-
Vgl.: R. Domes: Ravekultur und Drogenprävention – Selbstorganisation, Ekstasekonzepte und die Praxis von Drogenprävention als Ansatz von peer-group-education in den Projekten von Eve & Rave Berlin, in: Büro für Suchtprävention (Hg.): Ecstasy: Prävention des Mißbrauchs, Hamburg 1995, S. 39-50.

-
A. Schroers, W. Schneider: Drogengebrauch und Prävention im Partysetting. Eine sozial-ökologische Evaluationsstudie. Forschungsbericht, a.a.O., S. 163 ff.

-
Vgl.: H. Schmidt-Semisch: Zwischen Sucht und Genuß – Notizen zur Drogenerziehung, in: J. Neumeyer, G. Schaich-Walch (Hg.): Zwischen Legalisierung und Normalisierung, Berlin 1990, S. 140-146.

-
"Eve & Rave – Verein zur Förderung der Party- und Technokultur und Minderung der Drogenproblematik" trägt diesen Anspruch implizit schon in seinem Vereinsnamen.

-
A Schroers, W. Schneider: Drogengebrauch und Prävention im Partysetting. Eine sozial-ökologische Evaluationsstudie. Forschungsbericht, a.a.O., S. 137 ff.
Vgl.: F. Luhmer: Gedanken zur soziokulturellen Integration psychoaktiver Substanzen und der Emanzipation ihrer KonsumentInnen, unveröffentlichte Diplomarbeit, FU Berlin/FB Erziehungswissenschaften, Berlin 1998, S.59ff.
-
Vgl.: N.E. Zinberg: Soziale Kontrollmechanismen und soziales Lernen im Umfeld des Rauschmittelkonsums, in: P.J. Lettieri, R. Welz (Hg.): Drogenabhängigkeit – Ursachen und Verlaufsformen, Weinheim und Basel 1983, S. 256 - 266.

-
C. Rätsch: 50 Jahre LSD-Erfahrung. Eine Jubiläumsschrift, Solothurn und Löhrbach 1993, S.25.

| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
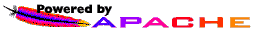

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |